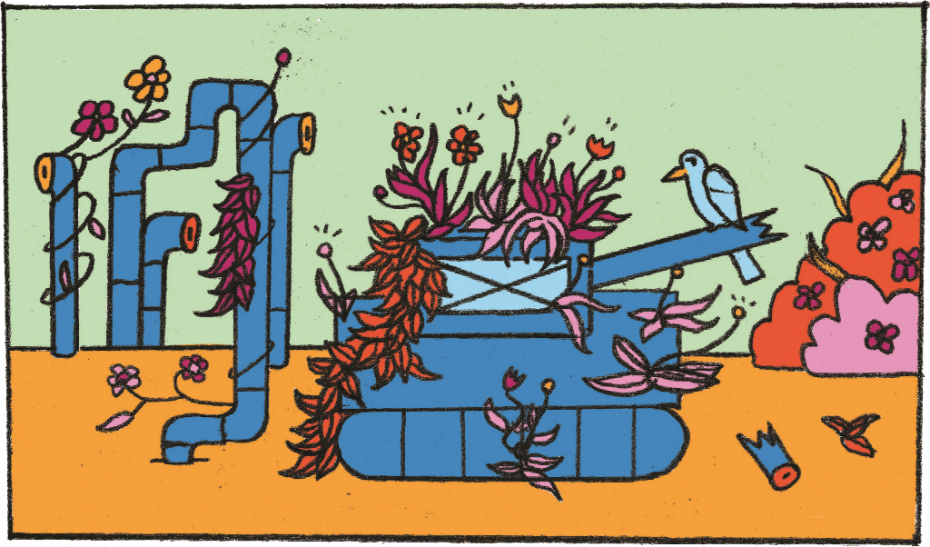Der Comiczeichner Jean-Marc Reiser ist Frankreich eine Legende. Hierzulande werden seine drastischen und wie hingeschmiert wirkenden Zeichnungen oft als obszön wahrgenommen. Dass ausgerechnet die frühere Frauen- und heutige Putinfreundin Alice Schwarzer zu seinen Fans gehört, hat ihm bisher nicht viel geholfen.
Einer seiner besten Strips trägt den Titel „Vor 37 Jahren“. Reiser schildert hier, wie sich ein deutscher Tourist und ein französischer Landbewohner unterhalten. Der Tourist war schon einmal in der Gegend, vor 37 Jahren, als Besatzer. Da der Franzose auch nicht gerade im Widerstand war, verstehen sie sich gut. Beide beklagen, wie sich die Landschaft verändert hat: Die Bäume sind weg, das kleine Bauernhaus ist weg, sogar das Herrenhaus ist verschwunden. Alles musste dem Beton weichen.
Der Tourist fängt an, über den Krieg zu schimpfen, doch der Einheimische unterbricht ihn: Die Katastrophe habe nicht der Krieg verschuldet, sondern die französischen Nachkriegspolitiker. Dem Deutschen bleibt nur ein ungläubiges „Ach?“
Die dreißig Glorreichen
Die Jahre von 1945 bis 1975 werden in Frankreich „les Trente Glorieuses“ („die dreißig Glorreichen“) genannt. Im kollektiven Bewusstsein sind sie als ein Zeitabschnitt in Erinnerung geblieben, der von Wirtschaftswachstum, gesellschaftlicher Modernisierung und allgemeinem Wohlstand geprägt war. Parallelen zum „Wirtschaftswunder“ in Deutschland und Österreich sind nicht zufällig, alle diese Länder waren in den gesamtwestlichen Nachkriegsboom unter US-amerikanischer Führung eingebunden.
Während heute rechte Parteien diese „gute alte Zeit“ zur Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte machen, sind in letzter Zeit auch Stimmen lautgeworden, die behaupten, dass jene dreißig Jahre nicht in jeder Hinsicht glorreich waren. So untersuchen die Historikerinnen Céline Pessis, Sezin Topçu und ihr Kollege Christophe Bonneuil in dem Band „Une autre histoire des ‚Trente Glorieuses‘“ („Eine andere Geschichte der ‚dreißig Glorreichen‘“) von 2013, wie Fortschritt, Modernisierung und Wachstum eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben, die sich etwa an vergifteten Flüssen, überdüngten Böden, Müllbergen und verseuchten Atomtestgebieten zeigt.
Doch damit nicht genug. Ausgerechnet jene konservativen Politiker, die wie General de Gaulle stets die Parole vom „ewigen Frankreich“ im Munde führten, haben die Zerstörung seiner bäuerlichen Grundlage zu verantworten.
2016 erschien in dem kleinen und feinen Verlag „Éditions L'échappée“ die Studie „Le sacrifice des paysans“ („Die Opferung der Bauern“) von Pierre Bitoun und Yves Dupont. Die Soziologen beschreiben, wie die französischen Bauern ab 1945 unter dem Einfluss des amerikanischen Modells dazu angehalten wurden, ihre Betriebe zu mechanisieren, chemische Mittel einzusetzen und ihre gesamte Produktion zu vermarkten.
All dies geschah unter dem Druck des Staates, der vor- und nachgelagerten Agrarindustrie, der Landwirtschaftskammern, der landwirtschaftlichen Berufsverbände und zahlreicher Wirtschaftswissenschaftler. Allesamt versprachen sie den Bauern eine goldene Zukunft. Viele glaubten es und machten fleißig mit.
Ein Ethnozid?
Die französische Landschaft änderte sich fundamental. In einem aufwändigen Planungsprozess ließ der Staat kleinere Flächen zusammenlegen, damit diese von den immer größer werdenden Maschinen befahren werden konnten. Alle störenden und unprofitablen Hecken, Knicks und Bäume – die jahrhundertalte „Bocage“ – wurden von Bulldozern plattgemacht. Aus kleinen, vielfältigen Betrieben wurde große, monokulturelle Ödnis.
Es war ein radikaler Paradigmenwechsel. Die Landwirte sollten nicht mehr die Bevölkerung satt machen, sondern Frankreich in eine global agierende Agrarmacht verwandeln. Lokale Produktionskulturen wurden fast vollständig vernichtet. Viele der kleinen Subsistenzhöfe – bis dahin das Fundament der französischen Landwirtschaft – gaben auf und verkauften ihr Land an jene, die schon viel hatten. Euphemistisch nannte man diese Revolution von oben „remembrement“ – Flurbereinigung.
Bitoun und Dupont beschreiben im Grunde den Abschluss jener „Verselbständigung der Ökonomie“, die der bedeutende Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi (1886-1964) rückblickend schon Jahrhunderte vorher in England wirken sah. Bitoun: „In der Landwirtschaft sind wir von einer Politik der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu einer entschieden exportorientierten Politik übergegangen, deren negative ökologische, gesundheitliche, soziale und menschliche Auswirkungen sich schnell bemerkbar machten. Die bäuerlichen Lebenswelten wurden zu einem Sektor der allgemeinen Marktwirtschaft.“
Die Autoren gehen sogar so weit, von einem bewussten und gewollten „Ethnozid“ an den französischen Bauern zu sprechen. Ist das übertrieben? Wenn man sich die noch heute abnehmenden Hofzahlen in Frankreich ansieht, ist man eher geneigt, ihnen recht zu geben.
Widerstand
Obwohl eine große Mehrheit der französischen Bauern den Versprechungen der „Experten“ Glauben schenkte und zu spät realisierte, in welch tödlichen Systemkreislauf sie das geführt hatte, gab es frühe Formen des Widerstandes. In beiden erwähnten Büchern sind Beispiele dafür zu finden.
Besonders anschaulich ist jedoch der Comic „Champs de bataille: L’Histoire enfouie du remembrement“ („Schlachtfelder: Die verschüttete Geschichte der Flurbereinigung“), den Inès Léraud und Pierre Van Hove 2024 vorgelegt haben. Der Band stützt sich auf zahlreiche Zeugenaussagen und historische Dokumente und beschreibt in Form einer Mikrogeschichte, wie sich einige bretonische Bauern gegen die Zwangszusammenlegungen und Zwangsenteignungen der Obrigkeit zur Wehr setzten.
Obwohl sie nur kleine Teilsiege erringen konnten, gemahnen sie ihre Nachfahren daran, dass der Mensch kein passives Objekt seiner Geschichte ist, sondern diese aktiv ändern kann. Dem Deutschen bleibt nur ein ungläubiges „Ach?“