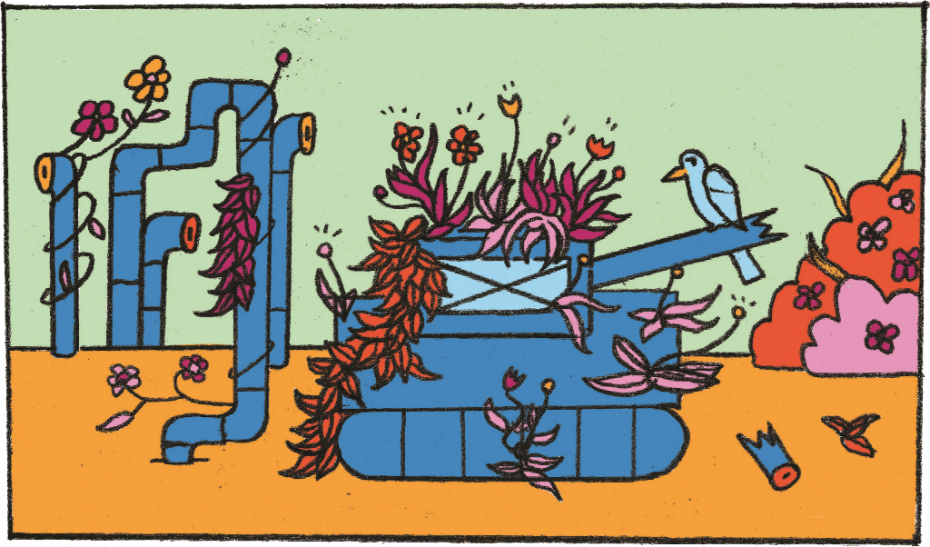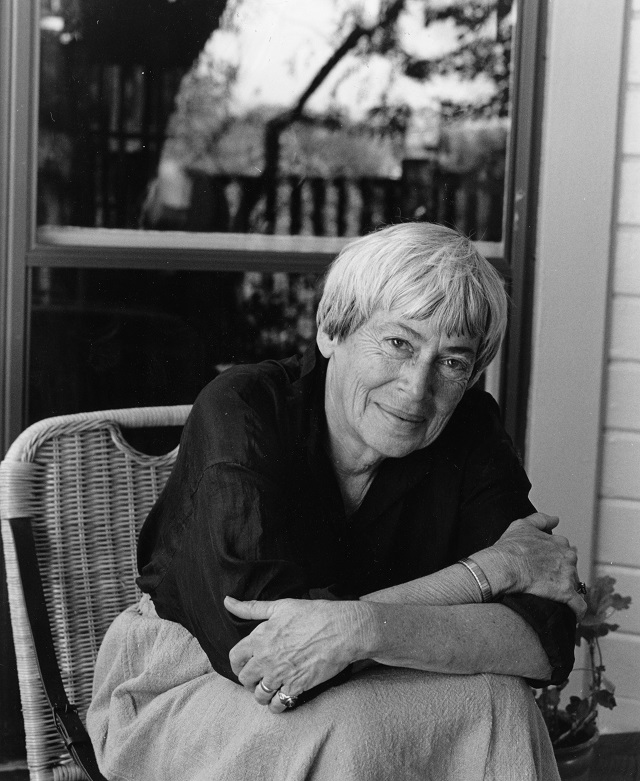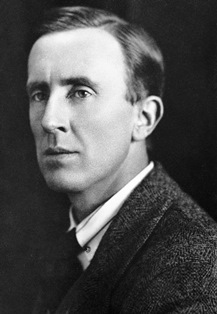Der 1868 im rheinhessischen Bingen geborene Stefan George sieht auf Fotos wahlweise wie eine verkniffene englische Großmutter oder eine schlecht gelaunte Vampirdame aus. Dabei war dem Poeten nichts wichtiger als sein der Außenwelt präsentiertes Selbstbild. Alle Porträts waren bewusst inszeniert und sollten ihn als ehrwürdigen Dichter-Propheten zeigen.
Schon als Schüler war der Sohn eines Weinhändlers ein Sonderling. Während sich seine männlichen Kameraden den üblichen Spielen hingaben, las er die Weltliteratur, dachte sich eigene Sprachen aus und begann Verse zu schreiben. Früh entdeckte er seine Homosexualität, die ihn noch mehr zum Paria machte.
Der Meister
Finanziell unabhängig, reiste der junge Mann in Europa herum. Prägend war die Begegnung mit dem Symbolisten Stéphane Mallarmé in Paris. Inspiriert von dessen Dichterkreis, begann George gleichgesinnte Jünglinge um sich zu scharen. Der „Georgekreis“ entwickelte sektenähnliche Züge, der Dichter ließ sich „Meister“ nennen und erklärte einen verstorbenen Jugendlichen kurzerhand zum Gott.
Was heute verstiegen und skurril wirkt, übte auf viele Zeitgenossen eine unheimliche Faszination aus. Auch die Brüder Stauffenberg waren Mitglieder des Kreises. Die letzten Worte des gescheiterten Hitlerattentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg sollen „Es lebe das geheime Deutschland!“ gewesen sein. Eine elitäre Formel, die direkt aus dem Georgekreis stammte.
George selbst war politisch uneindeutig und nicht gerade zimperlich, wenn es um die Verurteilung abspenstiger Jünger ging. Von den Nazis ließ er sich zwar nicht vereinnahmen, war ihnen aber auch nicht unbedingt feindlich gesonnen. Sein Werk enthält rassistische und chauvinistische Entgleisungen. Teile seiner jüdischen Gefolgschaft ließ er im Stich. Er starb am 4. Dezember 1933 in der Schweiz.
Lauter linke Leser
Vieles an George ist unangenehm. Warum sollte man ihn überhaupt lesen? Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass sich bei ihm Stellen finden lassen, die nicht nur als antibürgerlich, sondern sogar als oppositionell lesbar sind. In vielem, etwa in der Verachtung der preußischen Zwangsordnung, ist George Anarchisten wie Martin Buber und Gustav Landauer näher als rechtsradikalen Staatsfetischisten wie Carl Schmitt. In einem Brief vom Januar 1889 bezeichnete er sich immerhin als „Socialist, Communard, Atheist“. Nur eine Provokation?
Wie bei den meisten Schriftstellern ist auch bei George das Werk klüger und vielschichtiger als sein Autor. Das lässt sich anhand der Rezeptionsgeschichte belegen.
So hat das stampfend-vorwärtsdrängende Frühlingsgedicht „Einzug“ den Revolutionären der Münchner Räterepublik angeblich als Marschlied gedient: „Voll ist die zeit / Weckt was gefeit / Schlief mit dumpfem gegrolle“, heißt es da in der für George typischen Kleinschreibung. Etwas später dichtete Erich Mühsam, der aktiv an der Räterepublik teilnahm: „Reif ist die Zeit. Völker erhebt euch zum Streit! / Duldet nicht Herren noch Knechte“. George und Mühsam haben sicherlich nicht dasselbe gemeint, aber eine Art Wahlverwandtschaft gibt es trotzdem. „Sie alle sahen rechts – nur Er sah links“, lässt George den „Herren“ in einem Gedicht sagen. Ist das vielleicht doch wörtlich zu nehmen?
Viele Linke konnten nicht die Finger von Georges verführerischen Versen lassen. Walter Benjamin schrieb über ihn, Theodor Adorno vertonte Teile seines Werkes und Hans-Jürgen Krahl, der Studentenaktivist der 68er-Bewegung, hat angeblich stets einen Georgeband mit sich herumgetragen – in einer Plastiktüte.
Der Hauptgrund George zu lesen ist aber, dass er wirklich ein großer Dichter und in der Sprache tatsächlich ein Meister war. Viele seiner wie Zaubersprüche klingenden Verse wird man bereits nach der ersten Lektüre nie wieder vergessen. Gerade das auf den ersten Blick esoterische Spätwerk enthält – neben viel Zweifelhaftem – eine Fülle an Texten, die eingängig und schlicht wie das Volkslied sind. Außerdem war George ein bedeutender Naturdichter. Anders als die meisten hat er die Natur nicht idealisiert, sondern gekannt.
Dandy und Bauer
George entstammte einem zwar privilegierten, aber dennoch ländlichen Umfeld. Er war gleichzeitig überkandidelt und derb, ein Dandy und ein Bauer. Wenn Städter über Natur schreiben, wird es schnell sentimental, Natur wird zur Projektionsfläche für Sehnsüchte. Das gibt es bei George wenig. Im Gegenteil. Dass Natur auch bedrohlich sein kann, ist hier ein durchgängiger Topos. George bedient sich oft der altertümlichen Vorstellung, dass die Natur weiblich sei, mal will sie das Subjekt verschlingen, mal strebt dieses eine Partnerschaft an, wie im Gedicht „Der Freund der Fluren“ exemplarisch an einem Weinbauern vorgeführt wird. George lässt zwar der Wildnis ihren Bereich, pflegt aber das Ideal der Kulturlandschaft.
Im Gedicht „Verführer: I“ klagt er die industrielle Landwirtschaft und ihre Folgen an: „›Streut diesen sand und zweimal könnt ihr keltern / Und dreschen und das vieh ist doppelt melk. / Nun schwelgt und spottet eurer kargen eltern ...‹ / Doch übers jahr bleibt alles brach und welk.“ Heute wissen wir, dass unsere „kargen Eltern“ oft – und ohne es zu wissen – Ökobauern waren. George geht mit seinem Fortschrittspessimismus zu weit, trotzdem ist nicht zu leugnen, dass in alternativen Landwirtschaftsbetrieben vorwiegend alte Methoden wiederentdeckt werden. George war auch als Naturdichter konservativ, aber trifft das nicht auf alle Ökos zu? Geht es uns nicht allen ums „Bewahren“?
Mit links bewahren
Vielleicht trifft auf Stefan George die Kategorisierung „konservativer Revolutionär“ wirklich zu. Der Begriff wurde von einem Rechtsradikalen geprägt und ist nicht nur deshalb problematisch. Aber eins ist sicher: Echte Konservative müssen heute linksradikal sein, denn die Bedrohung all dessen, was es zu verteidigen und zu bewahren gilt, geht von jenem weltzerstörenden Kapitalismus aus, den auch George nicht mochte. „Ihr baut verbrechende an maass und grenze: / ›Was hoch ist kann auch höher!‹ doch kein fund / Kein stütz und flick mehr dient .. es wankt der bau.“ Manchmal haben sogar Propheten recht.