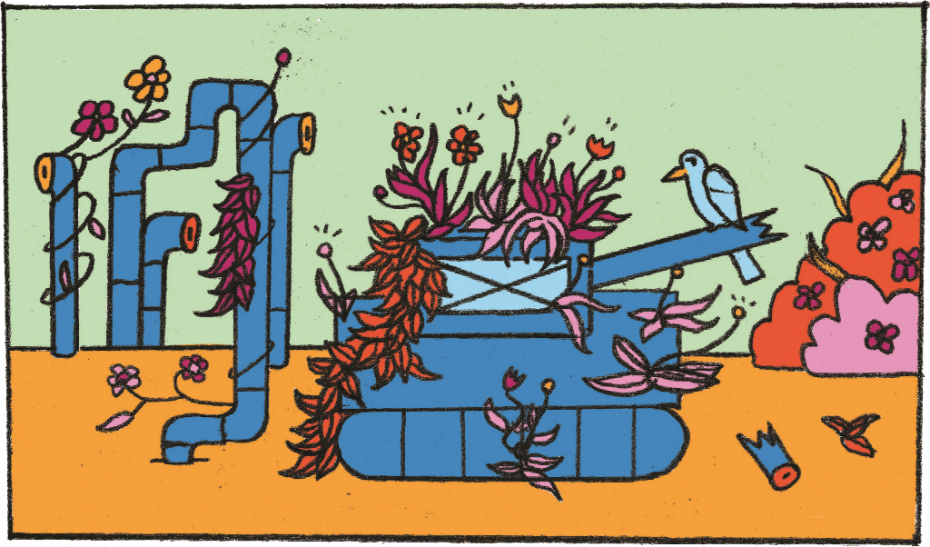Seit 1990 habe ich das Glück, im Naturschutzgebiet Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ, einem ehemals vegetationslosen Grenzgebiet der DDR ganz im Norden Berlins, das Wachsen der Natur bei null beginnend zu beobachten. Ich stelle es mir bildlich so vor, als würden pro Jahr alle Sträucher und Bäumchen um 30 Zentimeter in die Höhe wachsen. Es gibt dort jedenfalls eine zunehmende CO₂-Speicherung, anders als im deutschen Durchschnittswald laut dem letzten Waldzustandsbericht.
Dieses Gebiet muss ständig gepflegt und gewartet werden. Als „Berliner Mauerstreifen“ oder „Grünes Band durch Deutschland“ ist es ein beliebtes Ausflugsziel. Bei meinen Begehungen entdeckte ich interessante Naturbildungen am Wege, die unbedingt erhalten werden sollten. Man könnte sie durch ein Schild vor Vandalismus oder übereifrigen Pflegebetrieben schützen, vielleicht in folgender Art: „Liebe Wanderer und Besucher, hier wächst ein Naturdenkmal heran. Schützt es auch die nächsten 30 Jahre, bis es als Naturdenkmal geschützt und erhalten werden kann.“
Zwölf Kandidaten
Zwölf Exemplare habe ich ausgewählt, um sie den Verantwortlichen der Naturschutzbehörde bei einem Spaziergang zu zeigen.
Etwa 30 Jahre alte Kiefer mit zwei Buchensämlingen: Sie stehen am Ostrand des Grenzweges Richtung Rosenthal in Höhe der Naturschutzgebiets-Grenze. Vielleicht hat ein Eichelhäher vor mehreren Jahren hier Bucheckern als Wintervorrat vergraben und sie sind dann ausgetrieben. Er muss sie über mehrere Kilometer herangetragen haben, denn in der näheren Umgebung wachsen keine Rotbuchen, erst in Lübars oder im Botanischen Volkspark Blankenfelde. Die zwei Sämlinge sind inzwischen zwei Meter hoch.
Etwa 20 Jahre alte Esche am Schildower Weg: Westlich der Brücke des Schildower Weges über die Eisenbahn steht sie an einem Granitpfeiler. Diese Pfeiler wurden 1902 zur Sicherung des öffentlichen Weges gesetzt. Sie wurden mit Rohren verbunden, die in Bohrungen in den Pfeilern geschoben wurden. Die meisten Rohre sind inzwischen verrostet, doch ein Rohr steckt noch im Eschenstamm. Die Esche hat ihn umwallt und sich zu einem kräftigen Baum entwickelt.
Uralte Eiche auf Lübarser Seite: Wenige Meter entfernt von der ehemaligen Grenze steht diese kräftige Eiche, alle Bäume überragend. Sie könnte die Mutter aller jungen Eichen im Schutzgebiet sein. Weit mehr als 50 wurden von Eichhörnchen oder Eichelhähern dort „angesamt“. Die stärkste Jungeiche – auch sie eine Kandidatin – steht kurz vor dem Köppchensee am Mauerweg.
Vier Wildapfelbäume am Mauerweg: Diese Bäume stehen ganz in der Nähe der Jungeiche. Sie sind aus Apfelkernen herangewachsen, die Wanderer dort in den vergangenen Jahren hinterlassen haben. Schon bald nach 1990, als das „Unkrautgift“ seine Wirkung verloren hatte, wuchsen sie heran und bringen nun rote und gelbe, quietschsaure und sogar süße Früchte hervor. Inzwischen radelt man hier auf dem Grenzweg wie durch einen Tunnel aus Bäumen.
Kopfweiden am Aussichtsplatz zum See: Am Aussichtspunkt des Köppchensees stehen mehrere Kopfweiden. Sie werden aller zwei bis drei Jahre geköpft, früher eine Methode zur Gewinnung von Ruten für geflochtene Körbe. Die Weide reagiert darauf, indem sie einen Kopf und viele Jungtriebe bildet. Im Laufe der Jahre fault der Weichholzbaum innen aus und bietet Höhlenbrütern wie Star, Blaumeise und vielleicht auch mal dem Steinkauz einen Brutplatz. Die südlichen vier Weiden hat das Naturschutzaktiv aus abgeschnittenen Stängeln „gepflanzt“, wie sie die Bauern früher für Koppelzäune einsetzten. Hier hat sogar schon eine Blaumeise gebrütet (Rabe Ralf August 2022, S. 21).
Wild gewachsene Erle an der Brücke über das Fließ: Fast alle Erlen im Naturschutzgebiet sind durch eine Krankheit abgestorben. Doch diese junge Erle hat sich direkt am Mauerweg über das Tegeler Fließ selbst angesiedelt und konnte bis jetzt der Krankheit trotzen. Sie sieht fast wie ein Pfeiler der Brücke aus und wurde aufgeastet, das heißt die unteren Äste wurden entfernt, um Vandalismus keine Angriffsfläche zu bieten.
Alter Feldahorn am Weg nach Schildow: Unmittelbar an den ersten Häusern Schildows neben der Pferdekoppel steht ein kräftiger alter Feldahorn. Er hat der Grenzsicherung getrotzt und könnte mehr als 50 Jahre alt sein. Feldahorne sind äußerst selten in Wäldern, weil sie wegen ihres krummen und schiefen Wuchses kein Nutzholz bringen. Die Bauern haben sie aber in früheren Jahrhunderten gern als Brennholz genutzt, weil sie nach der Fällung wieder austrieben.
Speierling in der ehemaligen Obstwiese: Der Speierling war früher in Süddeutschland ein beliebtes Wildobst. 1993 war er Baum des Jahres. Wahrscheinlich im Jahr darauf wurde zwischen Kiesgrube und Schildower Weg ein Exemplar im Auftrag der Senatsverwaltung für Umweltschutz gepflanzt. 2024 hat der Baum das erste Mal Früchte getragen. Diese sehen wie kleine Äpfel oder Birnen aus.
Alter Wildbirnenbaum am „Schwarzen Weg“: Am Weg parallel zur Heidekrautbahn Richtung ehemaligem Bahnhof Blankenfelde steht der kräftige Wildbirnenbaum. Er hat das rabiate Grenzregime der DDR überdauert und steht in einer Apfelallee, die aber erst um 1995 gepflanzt wurde.
Junger Walnussbaum am Mauerweg: An der Kreuzung mit dem Schildower Weg steht der erst rund zehn Jahre alte Baum. Er wurde in den letzten Jahren aufgeastet, damit er Pflegefahrzeuge nicht stört. Der Walnussbaum ist wie die Wildäpfel eine freundliche Hinterlassenschaft der menschlichen Besucher.
Großer Haselbusch am Schildower Weg: Am Abzweig zur ehemaligen Kiesgrube steht der riesengroße Haselbusch inmitten der neu gepflanzten Hecke. Diese wurde ungefähr 1995 vom Pankower Naturschutzaktiv gepflanzt, nicht aber die Hasel. Hier hat wieder ein eifriger tierischer Besucher eine Nuss vergraben.
Wildkirschbaum an der Kiesgrube: Zehn Meter nördlich vom Haselbusch steht ein sehr wüchsiger Wildkirschbaum, ebenfalls 1994 durch die Senatsverwaltung gepflanzt. Er bringt wohlschmeckende Früchte hervor, aus denen schon mehrere Wildlinge wuchsen. Ein Sämling davon wurde vor mehr als zehn Jahren am Weg zur Fernverkehrsstraße B96, schon außerhalb des Naturschutzgebiets, gepflanzt und entwickelt sich langsam zum Baum – auch dieser könnte einmal Naturdenkmal werden. Ein benachbarter Kleingärtner half in manchem Sommer mit Wasser aus seiner Regentonne aus, wenn der kleine Baum zu vertrocknen drohte. Jetzt scheint er es geschafft zu haben.