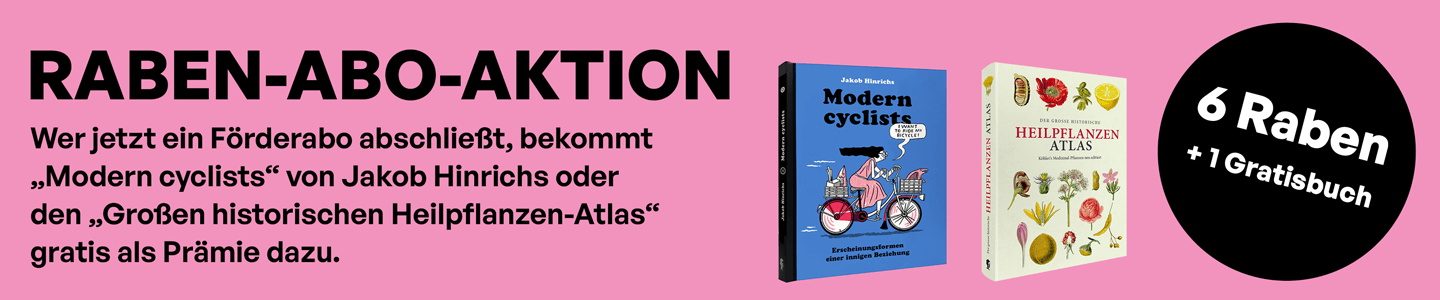Zum 500. Jahrestag der großen Bauernaufstände gibt es in diesem Jahr eine Fülle neuer Veröffentlichungen über die Ereignisse im Jahre 1525. Auch nach einem halben Jahrtausend sorgt der Aufstand noch für politischen Streit.
Einige konservative HistorikerInnen bestreiten immer noch, dass die Aufständischen überhaupt politische Forderungen hatten. Sie wollen in den Bauernkriegen nur eine interreligiöse Auseinandersetzung erkennen. Andere sehen in einigen Forderungen der Landbevölkerung gar frühe Vorläufer des Grundgesetzes. Dagegen beschäftigt sich Helge Döhring auf 160 Seiten mit der anarchistischen und anarchosyndikalistischen Rezeption.
Stark religiös geprägt
Dabei legt der Syndikalismusforscher den Fokus auf die Bewegung um Thomas Müntzer, die – obwohl stark religiös geprägt – eine radikale Gesellschaftsveränderung forderte. Wir erfahren bei Döhring, wie bekannte Anarchosyndikalisten wie Rudolf Rocker und Fritz Oerter vor genau hundert Jahren die Bauernrevolution beurteilten. Natürlich hoben auch sie Thomas Müntzer, der den sozialrevolutionären Flügel der Bewegung anführte, positiv hervor.
„Müntzer blieb fest bis zum letzten Moment. Er warf seinen Feinden noch mal ihre Grausamkeit gegenüber dem notleidenden Volk vor und erinnerte sie daran, welch schreckliches Ende nach der Bibel Tyrannen beschieden ist. Dann empfing er den tödlichen Streich, der ihm das Haupt vom Rumpfe trennte. So starb Thomas Müntzer am 30. (27.) Mai 1525 als Mann von fünfunddreißig Jahren“, beschrieb Rudolf Rocker das Ende des christlichen Sozialrevolutionärs.
Döhring befasst sich auch kritisch mit der widersprüchlichen Rezeption der Bauernrevolution in der DDR. Anders als in Westdeutschland wurde dort Müntzer sehr positiv bewertet, viele Straßen wurden nach ihm benannt, zahlreiche Gedenkorte errichtet. Gleichzeitig weist Döhring darauf hin, dass auch der „Bauernschlächter“ und Antisemit Martin Luther zum historischen Erbe gezählt wurde, auf das sich die SED zumindest seit den 1980er Jahren positiv bezog. Sie wollte Müntzer vereinnahmen, es sich aber auch mit den Anhängern seines Todfeindes Luther nicht verderben.
Auch für Laien lesbar
Solch ein opportunistisches Lavieren war dem Anarchismus fremd. So schrieb Fritz Oerter über die „große deutsche Revolution 1525“: „Der deutsche Staatsbürger, in Sonderheit der schaffende, das heißt der Angehörige des Arbeiter- und Bauernstandes soll um keinen Preis der Welt auf den Gedanken kommen, dass eventuell auch er wie alle Unterdrückten und Enterbten auf der Erde revolutionärer Gedanken und einer revolutionären Erhebung fähig ist.“
Oerter sah in den Erhebungen der Bäuerinnen und Bauern den Beweis, dass auch in Deutschland eine Revolution stattgefunden hat, die aber im Blut erstickt wurde. Die Rache der damals herrschenden Klasse an der Bevölkerung war fürchterlich, das wird auch im Buch deutlich.
„500 Jahre 1525“ ist auch für historische Laien, die keine Informationen über die Bauernrevolution haben, mit Gewinn zu lesen. Interessant sind auch Döhrings Reportagen aus zwei Zentren des damaligen Aufstands. So berichtet er von seinem Besuch in den Städtchen Stolberg und Allstedt, zwei wichtigen Wirkungsstätten Müntzers vor 500 Jahren, so anschaulich, dass man sich gerne selbst auf den Weg zu den Spuren der Bauernrevolution machen will.
Rezension zu:
- Autor
- Helge Döhring
- Titel
- 500 Jahre 1525
- Unteritel
- Thomas Müntzer und die Bauernkriege
- Verlag
- Verlag Edition AV, Bodenburg 2025
- Seiten, Preis
- 166 Seiten, 16 Euro
- ISBN
- 978-3-86841-328-1