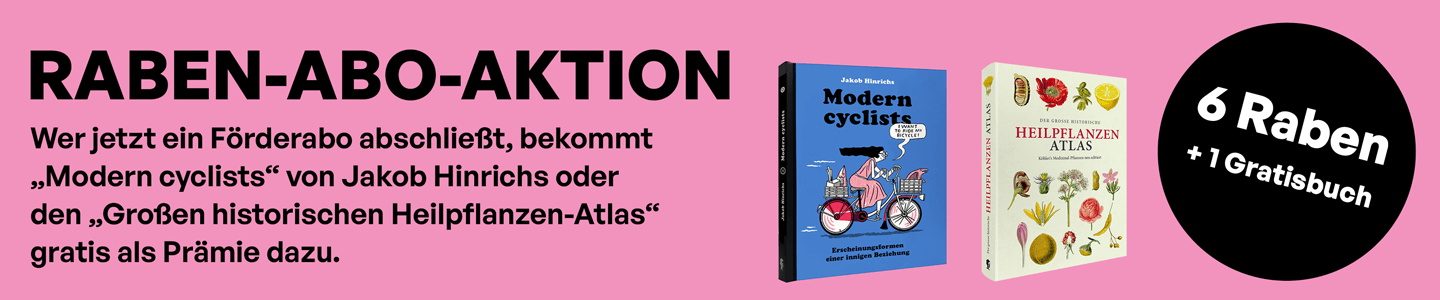Wolf von Fabeck, der Gründer und langjährige Geschäftsführer des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV), ist am 15. April kurz vor seinem 90. Geburtstag in Magdeburg gestorben. Er war eine der ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Klimapolitik.
Am 9. Mai 1935 wurde Wolf von Fabeck in Potsdam geboren. Die von Fabecks waren ein seit Jahrhunderten etabliertes Geschlecht preußischer Offiziere. Er wuchs in der Katastrophe auf, in die auch der deutsche Militarismus die Welt in der Mitte des 20. Jahrhunderts gestürzt hatte.
Vom Offizier zum Umweltschützer
1956 ergriff auch er die Offizierslaufbahn. Den 20-Jährigen trieb dabei die Sorge um eine militärische Überlegenheit der Sowjetunion. Nach einem Maschinenbau-Studium wurde er Dozent für Technische Mechanik und Kreiseltechnik an der Fachhochschule des Heeres in Darmstadt, später Dekan.
Trotz aller Wirrnisse des 20. Jahrhunderts liest sich das wie das Beschreiten einer vorgezeichneten Bahn. Dann aber ließ sich von Fabeck 1986 vorzeitig in den Ruhestand versetzen. Was war passiert?
1984 hatte er auf der ostfriesischen Insel Baltrum – seinem Lieblings-Rückzugsort – beobachtet, dass die Pflanzen auf der Seeseite abstarben, wenn draußen auf der Nordsee die Industrieschiffe Giftmüll verbrannten und der Wind landeinwärts stand. Seine Nachfrage beim Deutschen Hydrografischen Institut erbrachte nur Beschwichtigungen, unterfüttert mit einer Studie, die er sofort akribisch mit eigenen Messergebnissen verglich. Die Emissionen der Giftmüll-Verbrennung waren durch einen Rechenfehler um den Faktor eine Million zu niedrig angesetzt worden.
Die Behörde quittierte diese Information „beinahe kommentarlos“, doch einige Monate später wurde die Giftmüllverbrennung auf See verboten.
Elektrisierende Erfindung
Sein zweites „Erweckungserlebnis“ war die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Von Fabeck kam zu der Einsicht, dass der Kampf um den Erhalt der Umwelt wichtiger sei als der gegen geopolitische Gegner. „Leaving the Army to Fight“ überschrieb Bob Johnstone ein Kapitel über Wolf von Fabeck in seinem Buch aus dem Jahr 2010 über die Erfolgsgeschichte der deutschen Solarwende. Ein Militärgegner ist von Fabeck nie geworden, aber er setzte die Prioritäten nun auf die Verteidigung der Lebensgrundlagen.
Noch im Jahr 1986 gründete er mit ein paar Gleichgesinnten in Aachen den „Solarenergie-Förderverein“ (SFV). Zuvor hatte er Versuche mit einem Photovoltaikmodul unternommen, das er auf der Suche nach einer alternativen Form der Stromerzeugung erworben hatte – zu damals horrenden Kosten. Zu seiner eigenen Überraschung ließ sich mit dem so erzeugten Gleichstrom die Küchenmaschine seiner Frau Ursel in Betrieb setzen. Hier gab es offensichtlich eine Technik, die den Energiebedarf ohne Strahlengefahr und ohne Emissionen decken konnte, wenn man sie durch Massenfertigung preiswert machen würde.
Von Fabeck und seine Mitstreiter reisten durch die Bundesrepublik und zeigten auf öffentlichen Plätzen, dass man aus Licht Elektrizität machen kann, ohne dass sich irgendein Teil bewegen muss. Ab 1989 auch in der DDR, die bald zu den fünf neuen Ländern wurde.
Mit großer Beharrlichkeit
Die bloße technische Demonstration reichte aber nicht aus. Beim SFV entwickelten von Fabeck und seine Mitstreiter daher das Modell der „kostendeckenden Einspeisevergütung“. Bürger, die eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Hausdach installierten, sollten den geernteten Strom ins öffentliche Netz einspeisen dürfen und für jede Kilowattstunde eine Vergütung bekommen – hoch genug, damit sich die Investitionskosten amortisieren.
Die Vergütung sollte von allen Stromkunden entsprechend ihrem Verbrauch über die Stromrechnung aufgebracht werden. So sollten nicht nur die Idealisten von dieser Technik überzeugt werden, sondern auch Menschen, die aus wirtschaftlichen Motiven handeln.
Ein wenig lag die Idee damals in der Luft. An anderen Orten wurden ähnliche Konzepte entwickelt. Bei von Fabeck und dem SFV war das Modell allerdings sorgfältig durchgerechnet und wurde vor allem mit großer Beharrlichkeit auf kommunaler Ebene durchgesetzt – das Bundeswirtschaftsministerium hatte 1989 noch abgewunken.
Das „Aachener Modell“ wurde vom Stadtrat 1992 beschlossen und wegen des Widerstrebens der Aachener Stadtwerke später mehrfach bekräftigt. Bis zur Jahrhundertwende hatten etwa 40 Kommunen dieses Modell übernommen.
Dann wurde es von der rot-grünen Bundesregierung bundesweit vorgeschrieben: im „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG). Im Bundestag waren dabei Hermann Scheer (SPD) und Hans-Josef Fell (Grüne) die treibenden Kräfte. Man kann aber fragen, ob dieser Durchbruch ohne den unermüdlichen Einsatz von Fabecks denkbar gewesen wäre.
Der schwedische Technologiepolitik-Professor Staffan Jacobsson gab seinem Erstaunen mit den Worten Ausdruck: „Es war wirklich faszinierend, wie eine asketische, bescheidene Person mit einem kleinen Büro in einem Keller einen so großen Einfluss auf die Gesellschaft haben konnte.“ Und er fügte hinzu: „Er sollte vielleicht einen Nobelpreis bekommen.“
Erfolg vor dem Verfassungsgericht
Ein Teil der Antwort liegt wohl darin, dass von Fabeck in der Lage war, Menschen von seinen Ideen zu begeistern und damit selbst zu Vorreitern und Multiplikatoren zu machen. Ein anderer Teil der Erklärung ist, dass er nicht ganz aufhörte, ein preußischer Offizier zu sein. Wenn er eine Sache sorgfältig durchdacht hatte und zu einem Ergebnis gekommen war, dann brachte ihn so schnell nichts von seinem Weg ab. Seine Beharrlichkeit führte oft zum Erfolg.
Ähnlich war es später mit der Verfassungsklage gegen die klimapolitische Untätigkeit der Bundesregierung. Die Klage ging ganz maßgeblich auf eine Initiative von Fabecks zurück. Mit dem „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr 2021 hatte sie in wesentlichen Punkten Erfolg. Der Jurist Felix Ekardt, der die Klage vertrat, hielt von Fabecks Idee anfangs für völlig aussichtslos und wurde erst in jahrelangen Diskussionen überzeugt.
Wer mit Wolf von Fabeck zusammengearbeitet hat, weiß, dass sein Beharren auf einer einmal eingenommenen Position auch anstrengend sein konnte. Dies wurde aber ausgeglichen durch persönliche Bescheidenheit, Großzügigkeit und Warmherzigkeit. Das galt auch, wenn die Sprache auf die zunehmenden Umweltkatastrophen kam, über deren Opfer er mit großer Betroffenheit sprechen konnte.
Konsequent und weitsichtig
2012 zog von Fabeck mit seiner Frau nach Magdeburg zu Kindern und Enkeln. Bis zum Schluss reiste er jede Woche mit der Bahn nach Aachen, um Freunde zu treffen und im Kirchenchor zu proben. Auch dabei erlaubte er sich keine Inkonsequenz.
Den Nobelpreis hat Wolf von Fabeck nicht erhalten, aber für sein Lebenswerk wurde er 2005 von Eurosolar mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet. Auch der Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen Union, der 2023 an die Beschwerdeführenden in der Verfassungsklage verliehen wurde, zeichnete niemanden mehr aus als ihn.
Wolf von Fabeck hinterlässt eine große Lücke. Sein Mut, seine Weitsicht und seine Beharrlichkeit werden ein bleibendes Vorbild sein.