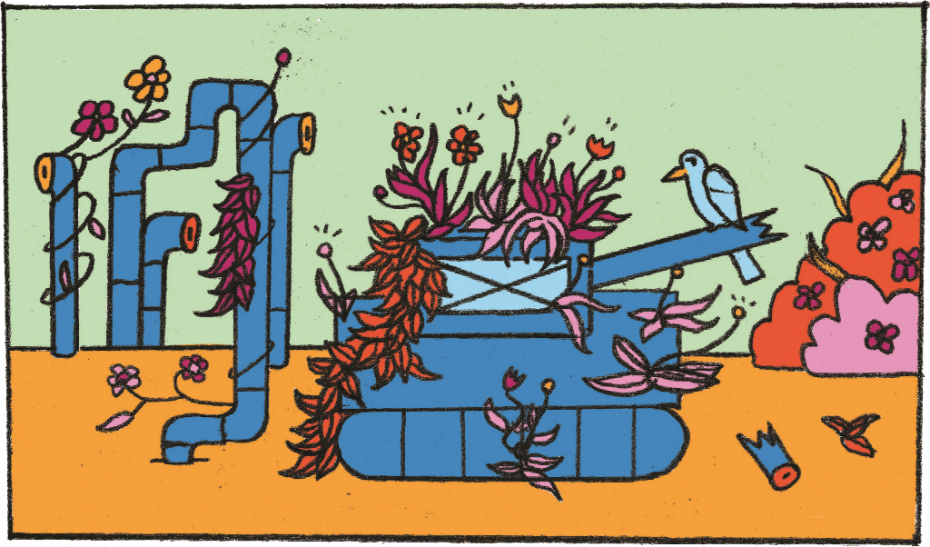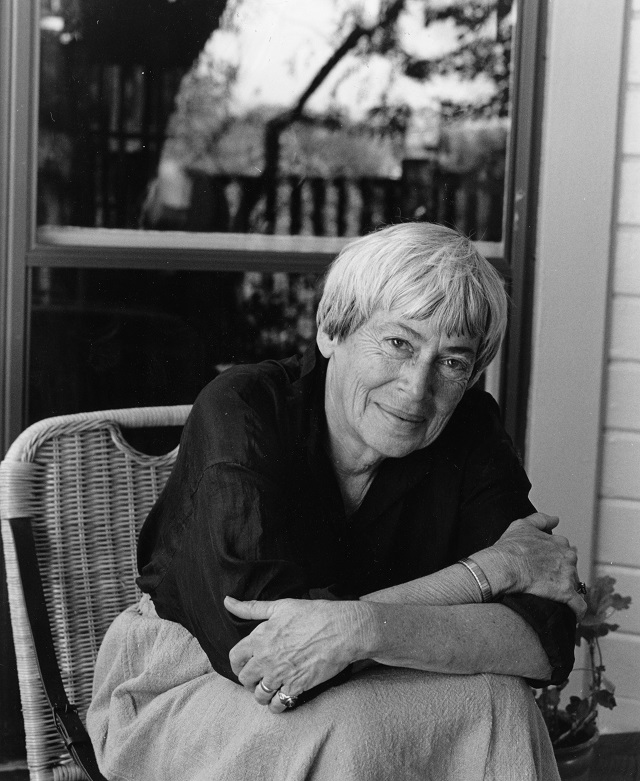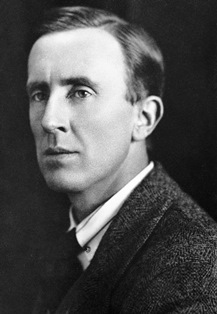Die Versuchung, das Scheitern der Ampel allein der separatistischen Syltpartei FDP in die Segelschuhe zu schieben, ist groß. Dass jene Regierung, die sich selbst einmal „Fortschrittskoalition“ nannte, nun der Vergangenheit angehört, liegt aber auch daran, dass es den mitbeteiligten Grünen erneut nicht gelungen ist, die drängenden Natur- und Klimaschutzthemen aus der eigenen Blase herauszuholen und wirklich populär zu machen.
In Erinnerung wird hier vor allem das „Heizungsgesetz“ bleiben, bei dessen Vermittlung Wirtschaftsminister Robert Habeck (der doch eigentlich als nationaler Erklärbär galt) grandios scheiterte. Dies kann nur in Teilen der Desinformations- und Hetzkampagne der markt- und bewusstseinsbeherrschenden Springer-Presse angelastet werden.
Die Folgen sind bekannt: Das Gesetz wurde stark aufgeweicht, die FDP sprengte trotzdem die Regierung und die AfD konnte sich mal wieder die Anti-Grünen-Stimmung zunutze machen und krakeelen, dass ein Kinderbuchautor nun mal von Wirtschaft keine Ahnung habe. Dabei ist Habeck weit eher vorzuwerfen, dass er als Kinderbuchautor gescheitert ist.
In Erzählungen verstrickt
Der für einen Philosophen erstaunlich unangestaubte Ernst Bloch suchte in seiner 1935 erschienenen Studie „Erbschaft dieser Zeit“ eine Antwort darauf, warum nicht der Sozialismus, sondern der Nationalsozialismus die Herzen der Massen gewonnen hatte. Seine These: Während die Sozialisten vor allem mit Zahlen, Fakten und Logik in den Wahlkampf gezogen waren, appellierten die Nazis an Gefühle, Mythen und tiefreichende Träume. Auch wenn sie das geplünderte kulturelle Erbe bis zur Unkenntlichkeit pervertierten und missbrauchten, verhalf es ihnen zum Sieg.
Um in Zukunft nicht noch einmal zu verlieren, müsse nun auch die progressive Front endlich Anschluss an das finden, was Bloch den „Wärmestrom“ einer Gesellschaft nannte. Soll das bedeuten, dass man auch die heutigen Nazis nur mit den eigenen Waffen schlagen kann? Dass selbst aufgeklärte Ökos in irrationale Tiefen hinabtauchen und einen „Mythus des 21. Jahrhunderts“ schaffen müssen?
Hier kann uns ein anderer Philosoph, Odo Marquard, beruhigen. Dieser erinnert daran, dass „Mythos“ zuerst einmal nur „Erzählung“ heißt. Marquard legt schlüssig dar, dass unser Zugang zur Welt immer durch Erzählungen vermittelt wird. Wir sind ausweglos „in Geschichten verstrickt“. Auch naturwissenschaftliche Wahrheiten (wie der Klimawandel), die meistens aus abstrakten Zahlen bestehen, sind uns nur zugänglich, wenn sie von Erzählungen eingerahmt werden. Der Mensch ist ein sich Geschichten erzählender Affe. Wir können aber immerhin darüber entscheiden, welche Geschichten wir uns erzählen.
Vor allem für einen Kinderbuchautor sollte all das nichts Neues sein. Dass dieser Beruf der AfD als Beleidigung gilt, sagt viel über ihr Bild einer Bevölkerungsgruppe, die sie doch eigentlich immer zu schützen behauptet. Kinder gieren geradezu nach Geschichten, die ihnen in einer verwirrend und chaotisch wirkenden Welt Orientierung bieten. Welcher Beruf kann also anspruchsvoller sein als der des Kinderbuchautors?
Auch Erwachsene wachsen nicht einfach aus Erzählungen heraus, sie versteifen sich aber auf einige wenige (leider oft die dümmsten). Ist ein vom Kinderbuchautor zum Politiker mutierter Erzähler also daran gescheitert, dass er der Wählerschaft keine guten und neuen Märchen erzählen konnte?
Eine Mythologie der Vernunft
Der von rechts kommende Dauerangriff betraf nicht nur Habecks Vergangenheit als Kinderbuchautor, sondern auch seine wissenschaftliche Karriere. Seine Dissertation wurde im Wahlkampf als Fälschung gebrandmarkt. Unberührt blieb immerhin seine Magisterarbeit, die sich Casimir Ulrich Boehlendorff widmet. Boehlendorff (1775-1825) ist auch Germanisten heute fast nur noch deshalb bekannt, weil er ein enger Freund des großen Dichters Friedrich Hölderlin war. Hölderlin selbst war wiederum Mitautor eines kleinen Textes, der vielleicht deswegen so selten gelesen wird, weil ihm der umständliche und abschreckende Titel „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ gegeben wurde. Dieses kurze und hochinteressante Dokument wurde um 1796 verfasst, sollte aber heute politische Pflichtlektüre sein.
Der Text ist als Handschrift Georg Wilhelm Friedrich Hegels überliefert, wurde inhaltlich aber auch von Hölderlin und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling geprägt, die sich damals als Schüler eine Stube in Tübingen teilten und gemeinsam für die Französische Revolution schwärmten. Die drei Feuerköpfe fordern darin nichts weniger als „eine neue Mythologie“, fügen aber sogleich hinzu: „... sie muß eine Mythologie der Vernunft werden.“ Etwas weiter heißt es: „So müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen, die Mythologie muß philosophisch werden und das Volk vernünftig.“
Diese radikale Idee ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die französischen Revolutionäre versuchten zeitgleich neue Volksfeste und nationale Erzählungen zu kreieren, um die errungenen Fortschritte im Volk zu verankern. Bereits 1792 wurde auf der Place de la Bastille ein „Brunnen der Regeneration“ errichtet, der gleichzeitig der Revolution und der Natur gewidmet war.
Aber steht nicht gerade die Französische Revolution für den unguten Populismus der Neuzeit, bei dem am Ende immer die Köpfe rollen?
Der gute Populismus
Für die linksliberalen bis konservativen Medien bedeutet Populismus immer gleich Trump, Orbán und Le Pen. Populismus ist, so die ewig wiederholte Erzählung, schmutzig mit der Tendenz zum Blutigen. Er bedient niedere Instinkte, ist gefährlich für Minderheiten und endet im Terror.
Diese Sorgen sind berechtigt, aber was ist die Alternative? Sollen die echten Zukunftsfragen ein ewiges Nischenthema bleiben? Den drohenden und jetzt schon akuten Umwelt- und Klimakrisen kann nur Einhalt geboten werden, wenn es die Politik schafft, Erzählungen zu finden, die stark genug sind, um Mehrheiten zu bilden und zu binden. Nur dann wird man auch bereit sein, „Opfer“ zu bringen.
Ironischerweise verlangt aber ausgerechnet ein Staat, der, im Bunde mit dem Wirtschaftssystem, selbst dafür sorgt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auszuhöhlen und aus seinen Staatsbürgern vereinzelte und egoistisch denkende Konsumenten zu machen, wieder nach einem „Dienst an der Gesellschaft“. Der leere Status quo soll notfalls sogar mit der Waffe verteidigt und mit dem Leben bezahlt werden.
Würde es die Sache besser machen, wenn es dabei um einen solidarischen Ökostaat ginge? Blicken wir noch einmal ins Systemprogramm. „Jeder Staat“, steht da, „muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“ Das ist nun aber wirklich ein bisschen viel verlangt, oder, wie Bloch sagen würde: eine Utopie.