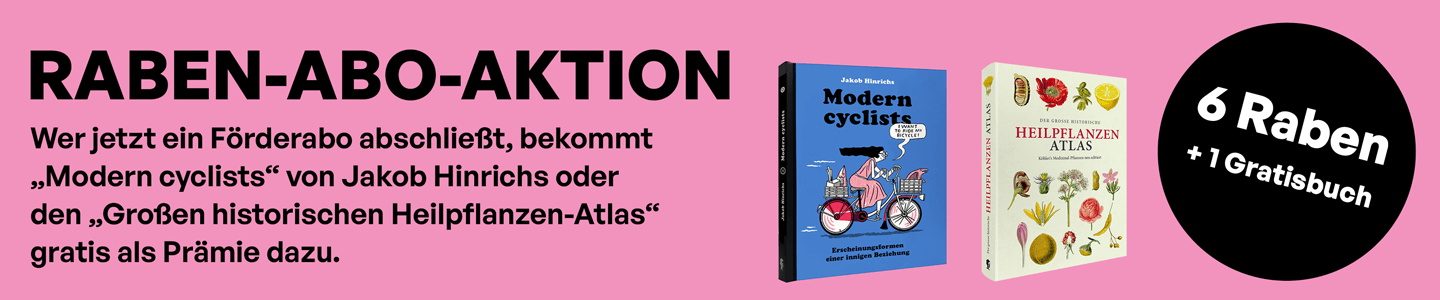Gegründet vor 35 Jahren in der DDR, blickt das Umweltnetzwerk Grüne Liga auf eine bewegte Geschichte zurück. Um die historischen Linien vom Umweltaktivismus in der DDR zum heutigen Engagement in Ostdeutschland nachzuzeichnen, luden die Grüne Liga und der Rabe Ralf Ende Juni zu einer Podiumsdiskussion ins Museum Pankow in Berlin-Prenzlauer Berg ein.
Als Einführung zeigte der Filmemacher und Spiegel-Redakteur Peter Wensierski eine kurze Dokumentation über den Einsatz für Umweltschutz in Dresden in den 1980er Jahren. Die Aufnahmen wurden heimlich in der DDR gedreht und ans ARD-Fernsehen geschmuggelt, für das Wensierski damals arbeitete. Sie zeigen eindrucksvoll, wie riskant Umweltaktivismus in der DDR war. Die starke Industriebelastung führte zu massiver Luftverschmutzung, doch Messdaten galten als Staatsgeheimnis. Umweltgruppen forderten Smog-Warnsysteme und die Veröffentlichung der Daten und stellten sich damit offen gegen die staatliche Autorität, was mit sehr hohen persönlichen Risiken verbunden war.
Starke Ökobewegung in der DDR-Wende
Laut dem Grüne-Liga-Mitgründer Klaus Schlüter gab es drei Hauptformen des Umweltengagements in der DDR: Betreuer:innen von Naturschutzgebieten, kirchliche Umweltgruppen sowie die Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU) im Kulturbund. Geschützte Räume, in denen sich Umweltengagement entfalten konnte, waren rar. Einige Gruppen schlüpften unter das Dach der Kirche, andere organisierten sich in den Stadtökologiegruppen innerhalb der GNU. All diese Gruppierungen – aus denen später die Grüne Liga hervorging – standen unter der misstrauischen Beobachtung der Staatssicherheit.
Doch im Laufe der 1980er gelang es vielen, sich neue Freiräume zu erkämpfen. Orte wie die Zionskirche in Berlin mit ihrer Umweltbibliothek und den „Umweltblättern“ oder das Kirchliche Forschungsheim in Wittenberg mit den „Briefen zur Orientierung im Konflikt Mensch–Erde“ wurden zu wichtigen oppositionellen Zentren. Die Umweltbewegung trug so auch zum gesellschaftlichen Umbruch 1989 bei. In der Wendezeit wurden wichtige Umweltprojekte durchgesetzt wie das Nationalparkprogramm und die Abschaltung der DDR-Atomkraftwerke.
Hitzige Diskussionen
Reka Schwarzbach von der Umweltgruppe Cottbus in der Grünen Liga lenkte den Blick vom Podium auf aktuelle Debatten in der Lausitz und die heutige Perspektive des Umweltengagements in Ostdeutschland. Die studierte Naturschützerin schilderte anschaulich, wie die Umweltbewegung heute, besonders im Osten, ein Tief durchlebt. Aktivist:innen würden häufiger kriminalisiert als im Westen.
Das liege auch am Druck großer Konzerne, die in der Region Arbeitsplätze sichern und die Politik mit Szenarien von Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise unter Druck setzen. Zudem seien viele Menschen noch stark mit der Industrie, und hier gerade der Braunkohle, verbunden – beruflich und gefühlsmäßig. Viele Arbeiter:innen ließen sich auch von den großen Unternehmen für ein kapitalistisches und umweltverschmutzendes System instrumentalisieren. Die in der Region sehr starke AfD mache solche Erzählungen zum großen Thema ihrer Wahlkämpfe.
In der Veranstaltung wurde deutlich, wie emotional aufgeladen das Thema bis heute ist. Aus dem Publikum wurden eigene Erfahrungen und Perspektiven eingebracht, wobei die Diskussion teils sehr hitzig verlief und mitunter abschweifte. Das zeigte, wie herausfordernd es sein kann, über Aktivismus in Ostdeutschland vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte ins Gespräch zu kommen und den Eindrücken verschiedener Zeitzeug:innen gerecht zu werden. Trotzdem bleibt die Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte wichtig. Nur wer sie kennt, kann heute wirksam Umweltaktivismus in Ostdeutschland betreiben.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der Rabe-Ralf-Ausstellung „Den Vogel zeigen“ statt. Die Wanderausstellung ist vom 10. bis 21. November wochentags auf einer Sonderausstellungsfläche des Bundesumweltministeriums in der Stresemannstraße 130 (Eingang Erna-Berger-Straße) am Potsdamer Platz zu sehen.