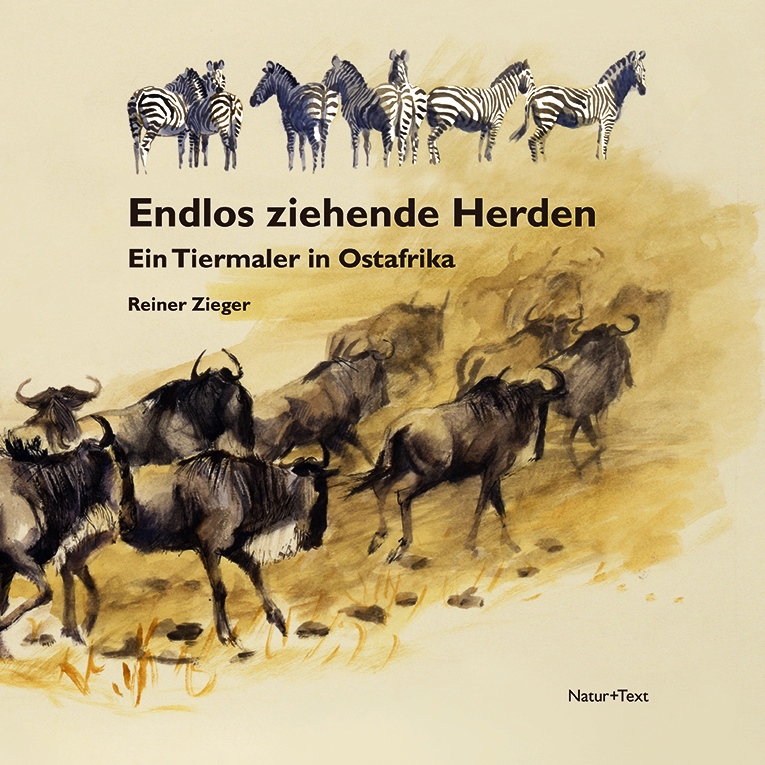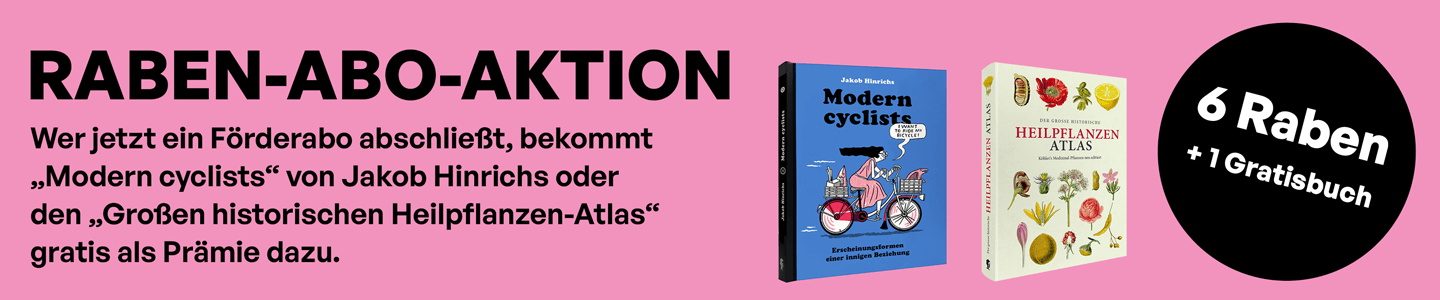Nach seinem Umzug aus Berlin in die Normandie durchforstete unser Autor Maurice Schuhmann die Buchbestände der örtlichen Bibliothek zu seinen Interessenschwerpunkten. Dabei fiel ihm „Ecopunk“ auf, eine soziologische Studie über ökologische Bezüge im Punkrock. Er sprach darüber mit Fabien Hein von der Universität Metz, einem der beiden Autoren.
Der Rabe Ralf: Fabien, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Studie über Öko-Punk zu verfassen? Bist du Vegetarier oder Veganer?
Fabien Hein: Mein vorheriges Buch „Do It Yourself!“ über Selbstbestimmung und Punkkultur hat mir ermöglicht, eine Menge Daten zu sammeln, die meinen Mitautor Dom Blake und mich überzeugt haben, unsere Forschung auf Ecopunk auszuweiten. Wie bei jeder Forschung stößt man manchmal auf wahre Schätze ... Außerdem, ja, ich bin Vegetarier, seit mindestens 30 Jahren. Wahrscheinlich unter dem Einfluss der Punkszene, durch Freunde, aber auch, weil ich mich noch nie wirklich zu Fleisch hingezogen gefühlt habe.
Eure Studie konzentriert sich auf den englischsprachigen Raum. Gibt es vergleichbare Entwicklungen und Beispiele im französischsprachigen Punk?
Ja, die angelsächsische Szene liegt mir am Herzen. Aber auch in Frankreich gibt es Gruppen mit ökologischen Ansätzen. Man könnte an Tagada Jones und ihr Lied „Ecowar“ denken. Ihre Texte sind exzellent. In Frankreich gibt es großartige Punkbands wie Guerilla Poubelle, La Fraction, Brigada Flores Magon oder Burning Heads. Doch das Bier-, Prügel- und Chaos-Image war für mich immer abschreckend. Gruppen wie Mano Negra, OTH, Les Sheriff oder Les Wampas waren etwas anders, Bérurier noir ebenfalls. Und Les Thugs waren völlig anders.
In meiner Jugend war ich von britischen Bands wie The Exploited, GBH oder Discharge beeindruckt, dann von der US-Hardcore-Szene mit Minor Threat, Bad Religion, Negative Approach, später von Post-Punk mit PiL und Joy Division. Fugazi hat mich dann völlig umgehauen. Es waren wirklich Fugazi, die meine Leidenschaft für die „intellektuelle“ Dimension des Punk entfacht haben. Meist aber eben im angelsächsischen Raum.
Dort ist auch das Werk des jüdisch-amerikanischen Ökoanarchisten Murray Bookchin allgegenwärtig. Wird er auch von Punkbands zitiert oder ist sein Konzept der sozialen Ökologie für den „Ecopunk“ irrelevant?
Bookchin passt in vielerlei Hinsicht sehr gut, auch sein libertärer Munizipalismus. In Frankreich wird er heute neu entdeckt. Für mich ist er eine Inspiration. Er wird, allerdings nicht oft, auch von Punks zitiert, ich denke besonders an Oi Polloi.
Dass sich viele Punks positiv auf die Tierrechtsorganisation Peta beziehen, überrascht mich. Natürlich gibt es auch in Deutschland bekannte Punks wie zum Beispiel Bela B., die Peta unterstützt haben, aber hier wird auch viel über Peta diskutiert, vor allem wegen der Holocaust-Vergleiche. Gibt es solche Debatten auch woanders?
Agrarindustrie und Massentierhaltung sind absolute Gräuel. Aber die Verbindung, die einige Peta-Aktivisten zwischen dieser Industrie und dem Holocaust herstellen, ist mehr als fragwürdig, besonders in Deutschland.
Meiner Meinung nach liegt das Problem in den Kommunikationsstrategien. Peta benötigt starke, spektakuläre Bilder, um seine Argumente zu untermauern. Der Vergleich mit dem Holocaust ist zwar spektakulär, schadet aber der Botschaft, da er Juden auf die Ebene von Tieren herabsetzt.
Massentierhaltung ist für sich eine Monstrosität, das steht fest. Aber es reicht meiner Meinung nach nicht, sie mit anderen Monstrositäten gleichzusetzen. Das ist sowohl ein kognitiver Fehlschluss als auch eine intellektuelle Täuschung und stört jede Möglichkeit des Nachdenkens. Petas Kurzschluss ist intellektuell äußerst ungeschickt.
Du hast auch über andere Musikstile publiziert. Gibt es dort eine ähnliche Rezeption von Ökologie oder Tierrechten oder ist das eine Besonderheit des Punk?
Die Welt des Metal ist nicht besonders politisiert, mit der bemerkenswerten Ausnahme des Grindcore, vertreten durch Bands wie Napalm Death aus Großbritannien oder Blockheads aus Frankreich – die ich beide sehr schätze. Einzelne Metalbands wie Gojira vermitteln eine ökologische Botschaft, aber es gibt kein Metal-Genre mit einer klar definierten Öko-Identität. Der „gallische Geist“ neigt eher zu parodistischem Metal wie bei der Gruppe Ultra Vomit. Ökologische Fragen oder soziale Kritik werden eher von starken Einzelpersönlichkeiten auf der ganzen Welt getragen.
Im Bereich Folk und Blues möchte ich William Elliott Whitmore erwähnen, einen herausragenden Sänger und Songwriter, der zu meinen Top Five zählt.
Beim Reggae würde ich Tiken Jah Fakoly aus Côte d’Ivoire nennen. Er hat mir den Zugang zum Reggae eröffnet. Ich bewundere sein kompromissloses politisches Engagement. Ein großer Mann. Sein Song „Le monde est chaud“ ist vermutlich das Eindringlichste, was ich in den letzten Jahren im Bereich der ökologischen Musik gehört habe. Auch Danakil ist für ökologische Themen sehr sensibilisiert. Im Raggamuffin-Genre bin ich ein großer Fan von Big Red. Seine Texte sind so genial wie sein Flow.
Die Band Shaka Ponk, die gerade ihre Karriere wegen der zu umweltschädlichen Tourneen beendet hat, hat ebenfalls interessante sozioökosystemische Überlegungen angestellt. Ich denke auch an einen Vertreter des Conscious Rap wie den großartigen KRS-One.
Und um ehrlich zu sein, habe ich auch eine besondere Zuneigung zu Meute, der Techno-Marching-Band aus Hamburg. Sie haben keine Texte, aber sie sagen sehr viel. Ich liebe diese Arbeitsteilung, diesen kollektiven Geist und vor allem liebe ich die unglaubliche akustische Energie, die von den Jungs ausgeht. Die instrumentale Dimension sorgt dafür, dass man nicht zu viel Mist redet. Das ist manchmal entspannend. Im Grunde genommen ist es sehr punkig, Action, Energie, Freude, Leben!
Auffällig ist, dass zumindest in der ersten Auflage von 2016 das Thema Atomkraft fehlt. Denke ich an deutschsprachigen Öko-Punk, fallen mir zuerst Lieder gegen Atomenergie ein, etwa von den Bands AufBruch oder Die Schnitter ...
Die französische Anti-Atom-Bewegung war relativ stark. Sie begann 1951 mit der Friedensbewegung und setzte sich in wichtigen Protesten mit manchmal tragischem Ausgang fort, zum Beispiel in Plogoff, Chooz, Bure oder Flamanville. Es gibt mehr als hundert Anti-Atomkraft-Gruppen in Frankreich, dennoch bleibt ihre Stärke geringer als in Deutschland. Als ich an Anti-Atom-Demos in Straßburg teilnahm, wo ich zehn Jahre lebte, waren die Demonstrationszüge vor allem von Deutschen geprägt. Das sagt ziemlich viel.
Vielen Dank für das Interview.
Buch: Fabien Hein, Dom Blake, „Ecopunk. Les punks, de la cause animale à l’écologie radicale“, Le Passager clandestin, Neuvy-en-Champagne 2023, 280 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-2-36935-308-9