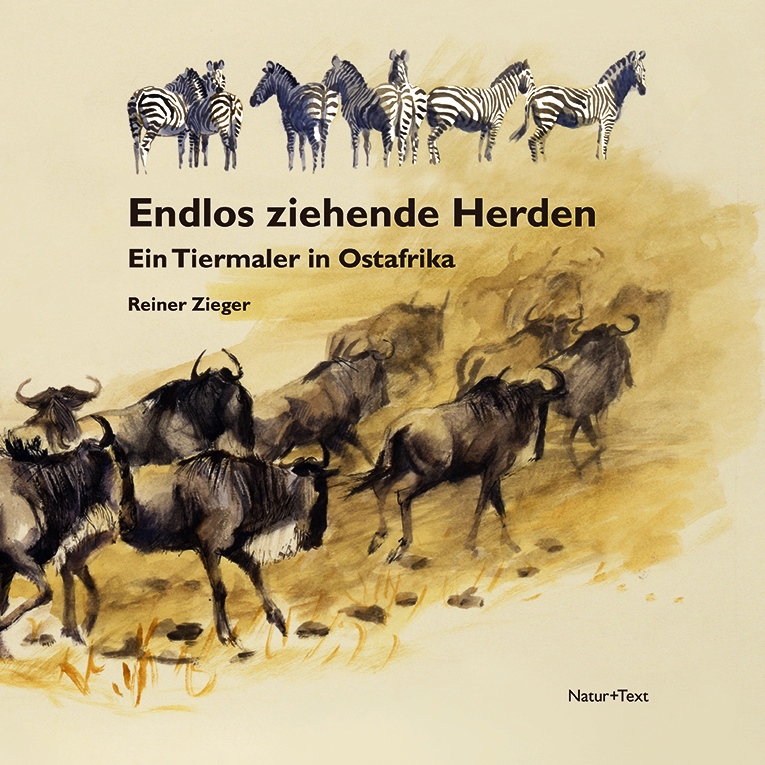Solarpunk ist ein relativ neues literarisches Genre, das erst in den 2000er Jahren aufkam. Bei der Strömung innerhalb der Science Fiction geht es um eine positive, nachhaltige Zukunft, in der Technologie, Natur und Gesellschaft harmonisch koexistieren.
Einige Wurzeln des Genres reichen weiter zurück, zum Beispiel zu dem 1975 erschienen Science-Fiction-Roman „Ecotopia“ des amerikanischen Schriftstellers, Journalisten und Universitätsdozenten Ernest Callenbach (1929-2012).
Anleihen bei Thomas Morus
Für seinen Roman, der heute als ein Klassiker des Genres gilt, fand Callenbach damals in den USA keinen Verlag, so dass er selbst einen gründete, den Verlag Banyan Tree Books. Seitdem ist „Ecotopia“ von unterschiedlichen Verlagen neu aufgelegt und in diverse Sprachen übersetzt worden. Die erste deutsche Übersetzung „Ökotopia“ erschien bereits 1978 im Rowohlt Verlag, und 2022 hat der Reclam Verlag eine Neuübersetzung herausgebracht.
Der Begriff Ökotopia setzt sich zusammen aus „öko“ von griechisch oikos (Haus, Haushalt) und „topia“ von griechisch topos (Ort). Wie der Titel schon andeutet, zeigt der Roman deutliche Anspielungen an Thomas Morus’ berühmtes Werk „Utopia“ von 1516. Ebenso wie „Utopia“ kommt „Ökotopia“ als Reisebericht daher – hier allerdings in Form eines Reisetagebuches.
Die Eintragungen beginnen am 3. Mai 1999, als der Protagonist, der Reporter William Weston, nach Ökotopia aufbricht, einem utopischen Staat, der sich vom US-Bundesstaat Washington über Oregon bis Nordkalifornien erstreckt. Aus anfänglicher Verwunderung und Distanz entwickeln sich bei dem Protagonisten immer mehr Verständnis und schließlich eine Begeisterung für den hier praktizierten Lebensstil.
Öko-Technik und freie Liebe
Ökotopia ist dabei das Sinnbild einer alternativen, dezentralen, hierarchiearmen Gesellschaftsordnung, in der technischer Fortschritt mit ökologischer Lebensweise und Gleichberechtigung der Geschlechter – die hier noch traditionell gedacht werden – einhergeht. Es gibt Bürgerversammlungen und eine 20-Stunden-Arbeitswoche.
Dabei werden die zeitgenössischen gesellschaftlichen Probleme in den USA wie der Umgang mit Rassismus pointiert aufgegriffen. Ganz im Sinne der damaligen Hippie-Stimmung hat Callenbach die Story mit viel Sex angereichert.
Was die ökologischen Utopien in dem Roman angeht, ist einiges davon heute schon Realität – in unterschiedlichem Maße. Die Nutzung von Solarenergie, ökologische Landwirtschaft ohne Pestizide, Müllrecycling und autofreie Städte oder zumindest Stadtzentren sind mittlerweile an vielen Orten in Europa zu finden. Für die USA mag vieles bis heute – und gerade heute – fern wie eine Utopie erscheinen.
Gleichzeitig – und das verbindet Callenbach mit Autorinnen wie Ursula K. Le Guin (Rabe Ralf Februar 2022, S. 20) – ist die beschriebene Gesellschaft noch lange kein Paradies auf Erden, wo alle Probleme gelöst sind. Erwähnt wird etwa der Tabakkonsum, der auch in Ökotopia noch anzutreffen sei.
Kultbuch der Jugend
Der Roman erschien drei Jahre nach Veröffentlichung des Club-of-Rome-Berichts „Grenzen des Wachstums“ und dem damit einhergehenden gesellschaftlichen Schock über den Zustand der Erde. Er spiegelt die Aufbruchstimmung jener Epoche sehr gut wider und wurde zu einem Kultbuch der jungen Generation.
In den USA stellten einige Medien das Buch in eine Reihe mit Werken der modernen Utopieliteratur wie Aldous Huxleys „Schöne Neue Welt“ und George Orwells „1984“. Auch in der wissenschaftlichen Utopieforschung war „Ökotopia“ wiederholt Gegenstand von Untersuchungen, zum Beispiel durch Richard Saage an der Uni Halle-Wittenberg („Utopische Profile“, 2001).
Sechs Jahre nach „Ecotopia“ veröffentlichte Ernst Callenbach ein Prequel zu dem Roman unter dem Titel „Ecotopia Emerging“. Im Zentrum steht hier die Vorgeschichte mit der gesellschaftlichen Umwälzung, die zur Gründung von Ökotopia führte.
Der Roman konnte bei Weitem nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen und fand ebenso wenig Beachtung wie die deutsche Übersetzung „Ein Weg nach Ökotopia“. Auch literarisch bleibt das Buch deutlich hinter seinem Vorgänger zurück.
Gut gealtert
Im selben Jahr wie dieser zweite Roman erschien in den USA der Band „Die Ökologie der Freiheit“ des Sozialökologen Murray Bookchin (Rabe Ralf Februar 2021, S. 16), in dem der Begriff Ökotopia eine erstrebenswerte Gesellschaft beschreibt. Später fand der Name auch Verwendung für ökologische Jugendcamps oder fairen Kaffee und Tee.
Und heute? „Ökotopia“ ist mehr als nur ein Klassiker mit einer geistesgeschichtlichen Bedeutung. Das Werk ist relativ gut gealtert und hat sich eine gewisse Aktualität bewahrt – leider. Denn wir sind von einer dezentralen, freien Gesellschaft so weit entfernt wie von einer, die mit der Natur in Einklang lebt.
Der Roman gibt also immer noch viele Anregungen und macht Lust darauf, für ökologischen und gesellschaftlichen Fortschritt zu streiten.