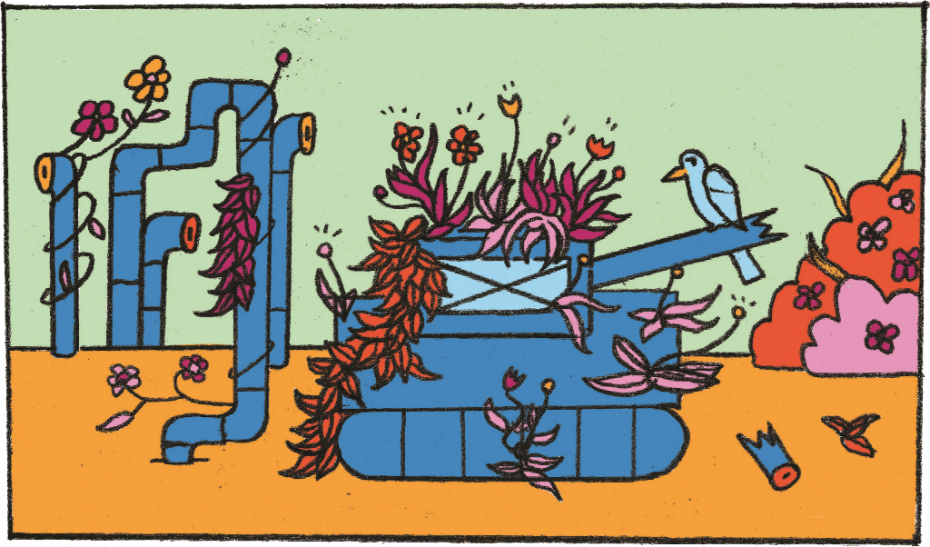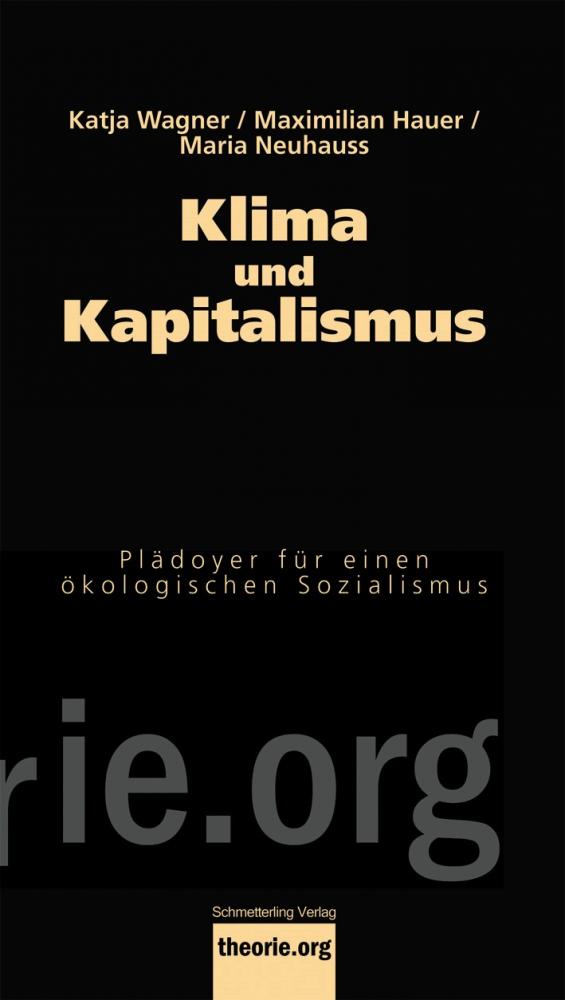Seit ein paar Jahren erlebt das Konzept des Ökosozialismus – ähnlich wie der Ökoanarchismus – eine Renaissance. Vergessen sind die stark autoritären Züge des ursprünglichen Ökosozialismus, der in den 1970er Jahren als Reaktion auf den ersten Club-of-Rome-Bericht „Grenzen des Wachstums“ entstand, mit seinen Vertretern Wolfgang Harich und Rudolf Bahro, die sich mehr oder weniger offen für eine Ökodiktatur aussprachen (Rabe Ralf Dezember 2024, S. 16).
Eine neue Generation von Theoretiker:innen unternimmt einen neuen Versuch, marxistische Wirtschaftstheorie und ökologisches Denken zu einer Symbiose zu vereinen. Dazu gehört zum Beispiel der japanische Philosoph Kohei Saito, der für einen „Ökokommunismus“ eintritt (Oktober 2023, S. 22), wobei er auch nur alte Argumente recycelt, die seit 50 Jahren zum ökosozialistischen Kanon gehören.
Kritik der Klimabewegung
Im deutschsprachigen Raum haben nun drei Mitglieder der Gruppe Translib aus Leipzig mit „Klima und Kapitalismus“ ein weiteres Werk vorgelegt, um Marx und Ökologie zu vereinen. Ihnen geht es erkennbar darum, die politischen und ökonomischen Triebkräfte hinter der Klimakrise zu analysieren. Der Ökosozialismus als solcher erscheint dabei – entgegen dem Untertitel – eher als ein Neben- oder gar „Abfallprodukt“ von dem, was etwas stiefmütterlich im letzten der acht Kapitel behandelt wird.
„Unser Buch ist parallel zum Abschwung des letzten großen Zyklus der Klimaproteste entstanden. Sein Ausgangspunkt war ein beim Klimastreik am 20. September 2019 verteiltes Flugblatt, mit dem wir zur Radikalisierung der Klimabewegung beitragen wollten, die sich seinerzeit weithin als post-politische Ein-Punkt-Politik präsentierte“, erklären Katja Wagner, Maximilian Hauer und Maria Neuhauss in der Einleitung.
Privilegierte Ökos
Die Autor:innen stellen selbst fest: Karl Marx' Kritik der politischen Ökonomie reicht nicht aus, um die ökologischen Krisen der Gegenwart zu begreifen. Trotzdem lösen sie sich nicht von den marxistischen Analysen. „Notwendig ist Marx' Theorie dennoch, da sie die allgemeinen Formbestimmungen der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem inneren Zusammenhang sowie in ihrem widersprüchlichen Verhältnis zur stofflichen Welt aufdeckt.“
Im weiteren Verlauf schreiben die Autor:innen unter anderem über linke Ansätze, etwa die Vorstellungen von Extinction Rebellion oder der Postwachstumsbewegung – wobei unausgesprochen die Kritik mitschwingt, dass diese sich nicht an der marxistischen Analyse orientieren.
Das hat zeitweilig etwas sehr Dogmatisches, was in Zeiten der Klimakrise sicherlich nicht angebracht ist. Vor dem Hintergrund der Bedrohung sollte man nicht den einzigen wahren Weg predigen, sondern ein Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze zur Verhinderung des Gröbsten zumindest tolerieren.
So ist die folgende Kritik zwar gerechtfertigt, scheint mir aber doch eher ein Nebenschauplatz zu sein: „Problematisch ist zudem, dass ein ‚ökologischer‘ Lebensstil gegenwärtig ein Privileg bestimmter Gesellschaftsschichten ist. Bioprodukte sind teuer und scheinen gleichzeitig die besondere Tugend ihrer Käufer:innen aus der gebildeten urbanen Mittelschicht zu bestätigen.“
Bessere Planwirtschaft
In ihrer Auseinandersetzung mit dem derzeitigen Ressourcenverbrauch im kapitalistischen Wirtschaftssystem kommen Wagner, Hauer und Neuhauss zu der Einschätzung: „Wie wir in den vergangenen Kapiteln dargestellt haben, ist der Klimawandel als Effekt der kapitalistischen Produktionsweise zu verstehen, die zentral auf einem fossilen Energiesystem aufbaut. Ist der Klimawandel einerseits durch die Gesellschaftsordnung verursacht, kann er andererseits in ihrem Rahmen nicht effektiv eingedämmt werden, da sich die Produktion aufgrund des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Trennung der Produzent:innen voneinander der gesellschaftlichen Kontrolle entzieht.“
Damit leiten sie das eigentliche Thema ein: den Ökosozialismus, der auf gerade mal zwanzig Seiten abgehandelt wird. Wer sich darauf besonders gefreut hatte, wird leider etwas enttäuscht. Hier wird noch einmal das Konzept einer Planwirtschaft aus der Mottenkiste geholt – allerdings in Abgrenzung zu den Erfahrungen der Staaten des real existierenden Sozialismus.
Vor diesem Hintergrund wird auch das Verhältnis von Ökosozialismus und Demokratie behandelt, wobei der Ökosozialismus auch als eine „ökologische Klassenpolitik“ umschrieben wird. „Ökologie und Demokratie schließen sich zwar nicht aus, können aber auch in einer sozialistischen Gesellschaft in Spannung zueinander geraten.“ In jedem Fall sei die Grundlage klar: „Innerhalb der Debatte um einen ökologischen Sozialismus ist man sich darüber einig, dass ein Ende der umweltzerstörerischen Produktions- und Lebensweise nur durch eine Überwindung des Kapitalismus möglich ist.“
Theoretisch gelungen
Das Werk hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Die Klimakrise und ihre Hintergründe werden sehr gut dargestellt und auch die Anwendung von Marx ist sehr fundiert. Die pointierte Kritik an Gruppen wie Extinction Rebellion ist ebenfalls gelungen. Daran gibt es nichts zu kritisieren.
Dennoch stellt sich die Frage, ob der marxistische Ballast, den das Buch ins Hier und Jetzt zu retten versucht, wirklich weiterführt. Die Darstellung und Ausformulierung eines Plädoyers für einen ökologischen Sozialismus fällt im Vergleich zu den anderen Abschnitten stark ab. Das Buch bietet hier wenig Tiefgang und noch weniger neue Ideen. Über Ökosozialismus gibt es deutlich Besseres und Relevanteres zu lesen. Diese Aspekte wurden bei dem Versuch einer Rettung der marxschen Theorie vernachlässigt. Schade.
Rezension zu:
- Autor
- Katja Wagner, Maximilian Hauer, Maria Neuhauss
- Titel
- Klima und Kapitalismus
- Unteritel
- Plädoyer für einen ökologischen Sozialismus
- Verlag
- Schmetterling Verlag, Stuttgart 2025
- Seiten, Preis
- 204 Seiten, 15 Euro
- ISBN
- 978-3-89657-645-3