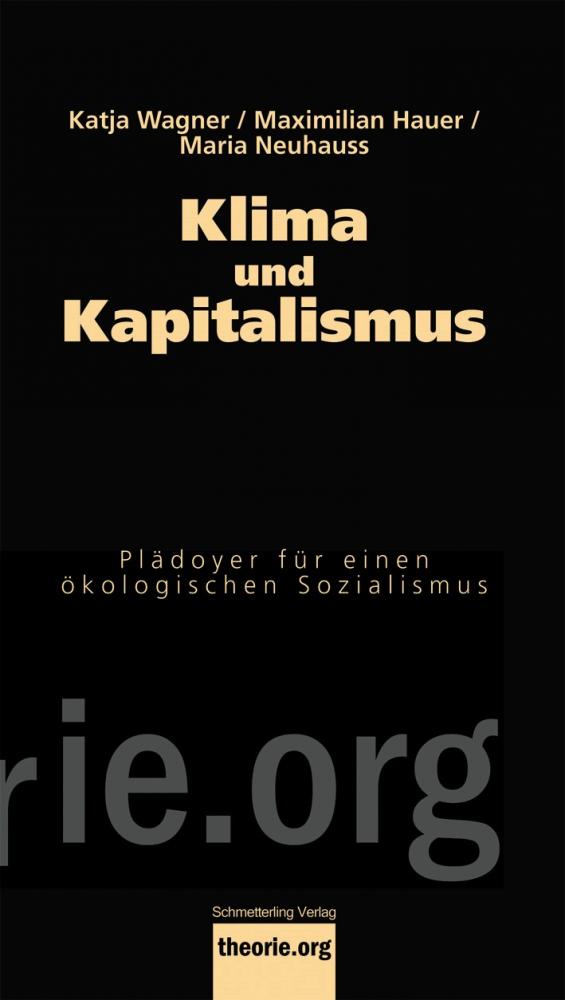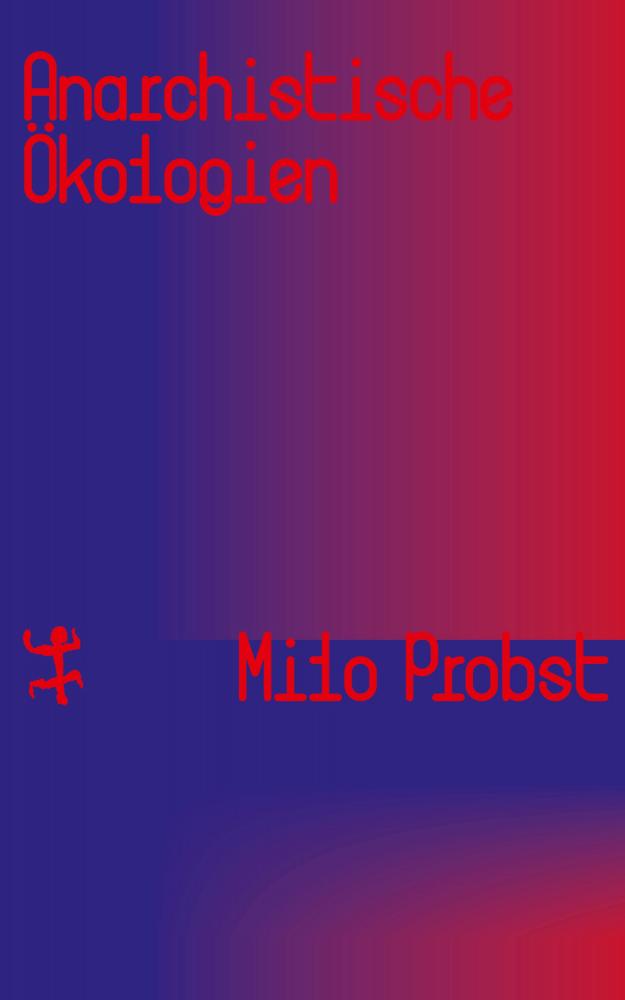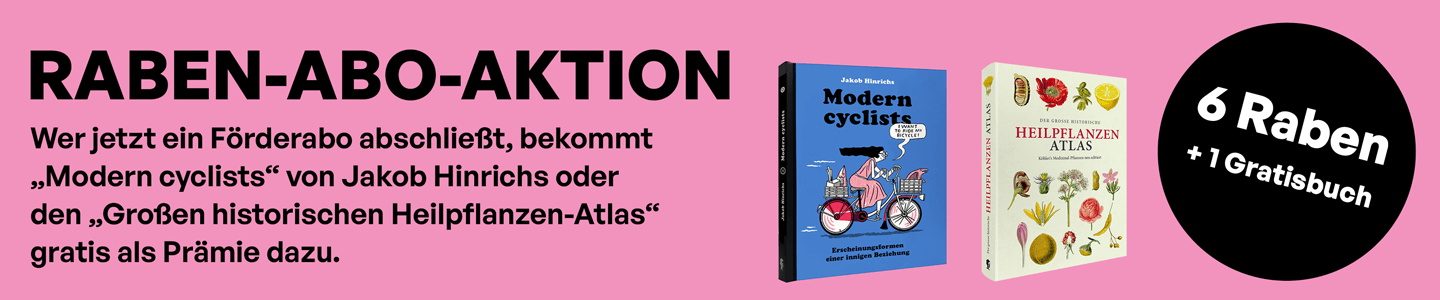Das Phänomen Autoverkehr ist kein Mysterium. Auch wenn es sich so anfühlt, auch wenn es in seiner Dimension unfassbar, unbegreifbar und monströs erscheint. Jedoch entzieht es sich in seiner Vielschichtigkeit der einfachen Erklärung. So ist es nicht verwunderlich, dass es diverse Ansätze gibt: technische, wirtschaftliche, administrative, planerische, politische und psychologische.
Ein Ansatz der Analyse und Deutung blieb bisher weitgehend unbeachtet: der soziologische. Das ist verwunderlich. „Mobilität“, sagt die Soziologin Katharina Manderscheid, „gehört zu den wesentlichen Eigenschaften des Sozialen.“ Das ist für sie Grundlage und Motiv ihres Buches „Soziologie der Mobilität“.
Auch wenn es eher als wissenschaftliches Lehrbuch erscheint, ist es bis auf wenige Begriffe erstaunlich gut zu verstehen. So gibt es Erklärungen für das, was sich auf unseren Straßen abspielt, aber auch in „unseren“ Köpfen. Denn die über 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen, die 23 Stunden am Tag herumstehen und die Besitzer 400 oder mehr Euro im Monat kosten, sind nicht nur individuell erklärbar. Es geht um eingeschliffene Selbstverständlichkeiten. Die Nutzung wird nicht mehr hinterfragt, sonst würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen.
Teil des Organismus
Das System des motorisierten Individualverkehrs ist zu einem Teil des Organismus (gemacht) geworden, der nur noch mit dem Dopingmittel Energie aufrecht gehalten werden kann. Wenn von den gigantischen 2,3 Billionen Kilowattstunden, die hierzulande jährlich verbraucht werden, rund 30 Prozent in den „Verkehr“ gehen, dann haben wir eine Vorstellung von der Aufgabe, die technisch, ökonomisch und sozialpsychologisch vor uns steht. Denn seit Jahrzehnten, so könnte man es formulieren, bewegen wir uns durch eine Scheinwelt, die uns dank der Verbrennung von (fossilen) Kohlenstoffverbindungen vorgegaukelt wird.
Der Erwerb des Führerscheins ist immer noch ein Initiationsritus, um zum vollwertigen Mitglied der modernen Erwachsenengesellschaft zu werden. Das Auto wurde spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts in das Denken und die Normalitäten des Alltags „eingewoben“. Es spricht einiges dafür, dass das Auto zu einem Element des eigenen Körpers und darüber hinaus zum gesellschaftlichen Körperteil geworden ist. Entsprechend schwer dürfte der Verlust, der einer Amputation gleicht, zu verkraften sein. Der Irrweg, der mit der Massenmotorisierung beschritten wurde, wird immer deutlicher, auch wenn große Teile der Gesellschaft es nicht wahrhaben wollen oder wider besseres Wissen handeln.
Motivation und Notwendigkeit
Oft sind dabei die Nutzer des Pkw sowohl Täter als auch Opfer. So hat sich die gesamte Raumstruktur, ganz besonders die ländliche, auf die Nutzung des Autos eingestellt, mehr noch, sie ist durch das Auto erst provoziert und ermöglicht worden.
Kann man das Thema akademisch distanziert betrachten, wenn zum Beispiel in einer niedersächsischen Kleinstadt laut einer Erhebung von 2008 an jedem Werktag rund 87.500 Kfz-Fahrten innerhalb der Kernstadt zurücklegt werden – im Mittel über eine Distanz von knapp zwei Kilometern? In einer Stadt, deren Radius um den Marktplatz kaum zweieinhalb Kilometer beträgt. Weil die Bürger dieser kleinen Stadt nicht anders können? Da wundert es nicht, wenn die Klimaziele des Verkehrs weit entfernt sind.
Das ist eine politische Frage. Deshalb kann Manderscheid nüchtern analysieren: „Innerhalb des Zusammenhangs von Mobilität und Moderne spielt das Auto, genauer: das private Auto, eine besondere Rolle. Aus mobilitätssoziologischer Sicht handelt es sich beim Automobil nicht um ein technisches Fortbewegungsmittel neben anderen, beispielsweise dem Bus, dem Fahrrad oder der Eisenbahn. Vielmehr ist das private Auto elementarer Bestandteil moderner Gesellschaften und Lebensführung. Das bedeutet jedoch nicht, dass Automobilität in der bestehenden Form aus einer funktionalen Notwendigkeit entstanden ist, also eine grundsätzlich existierende Nachfrage bedient und damit auch in Zukunft unabdingbarer Teil gesellschaftlichen Lebens sein muss. Weiterhin bedeutet dies auch nicht, dass sich das Auto als technisch beste Lösung des Verkehrsproblems durchgesetzt hat. Gemeint ist vielmehr, dass Automobilität als prinzipiell kontingente [mögliche, aber nicht notwendige] Form der Mobilitätsorganisation die räumliche, ökonomische und soziale Struktur der Gesellschaft geprägt hat und Teil derselben geworden ist.“
Das Auto ist, so kann man es sehen, eine Begleiterscheinung der ökonomisch-sozialen Entwicklung. Man hat und gebraucht es, weil man es kann. Wobei häufig verschleiert wird, dass die Basis dieser Entwicklung der exzessive Einsatz von Material und fossiler Energie ist, bei der Herstellung wie beim Gebrauch.
Nach der Entziehungskur
Wie ist es dazu gekommen? Die Frage bleibt weitgehend unbeantwortet. Dass dies politische Entscheidungen waren und wie sie zustande kamen, dürfte von Historikern geklärt werden.
„So entschied der Berliner Senat Anfang der 1960er Jahre, die Straßenbahn in Westberlin, mit der zu diesem Zeitpunkt mehr Menschen befördert wurden als mit allen anderen Verkehrsmitteln zusammen, abzuschaffen“, heißt es im Buch. Die fatalen Folgen sind seit Langem schmerzlich zu erleben. Welche Interessen haben das Denken und Handeln von Senat und Abgeordnetenhaus damals beeinflusst?
Manderscheid: „Erst ein Verständnis der Einbettung des Autos in die Gesellschaft macht verständlich, warum die gegenwärtig geforderte Verkehrswende, eine Abkehr vom Automobil als dominantem Verkehrsmittel, in der Praxis so schwierig umzusetzen ist.“ Heutige Gesellschaften würden als Auto-abhängig beschrieben. „Im Zuge dieser Entwicklung wurden im Lauf der Geschichte ökologisch nachhaltigere Formen wie öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zunehmend verdrängt und deren Re-Etablierung als Verkehrsmittel der Massen erschwert.“
Es ist vermutlich eine der Schlüsselfragen, wie die Autonutzung, die „zu einem zentralen Mittel zur Befriedigung verschiedener menschlicher Bedürfnisse geworden ist“ oder gemacht wurde, substituiert werden kann. Sollten wir es mit einer riesigen Menge psychisch wie körperlich Abhängiger zu tun haben? Wie könnte ein „Auto-Methadon“ aussehen – und wie die Gesellschaft nach der Entziehungskur einer wirklichen Verkehrswende? Interessante Fragen auch für die kritische Soziologie.
Open Access: doi.org/10.36198/9783838555812
Rezension zu:
- Autor
- Katharina Manderscheid
- Titel
- Soziologie der Mobilität
- Verlag
- Transcript Verlag, Bielefeld 2022
- Seiten, Preis
- 216 Seiten, 22 Euro
- ISBN
- 978-3-8252-5581-7