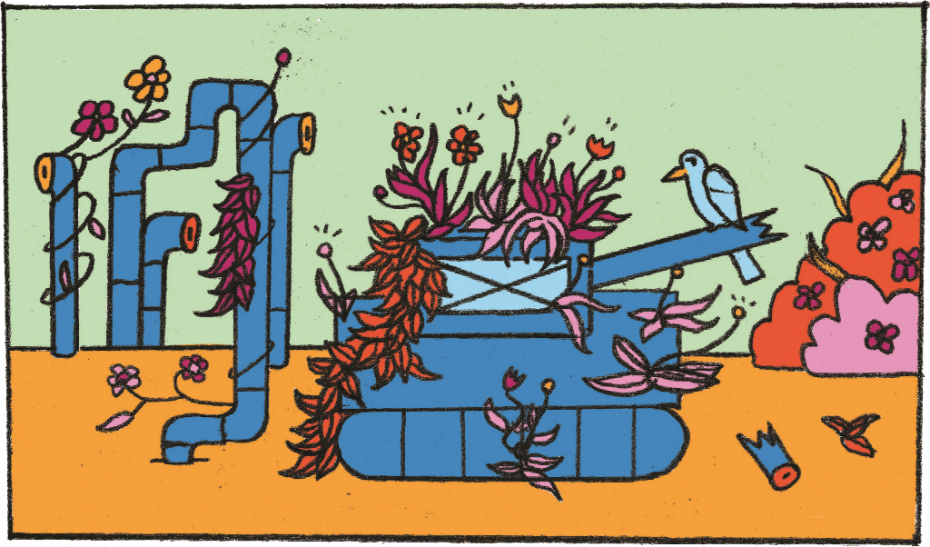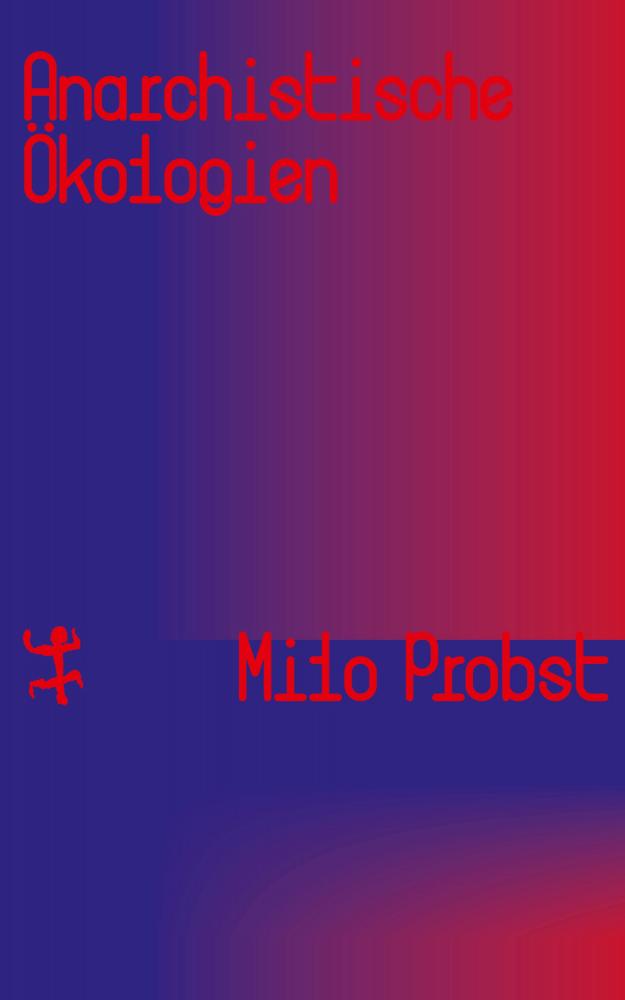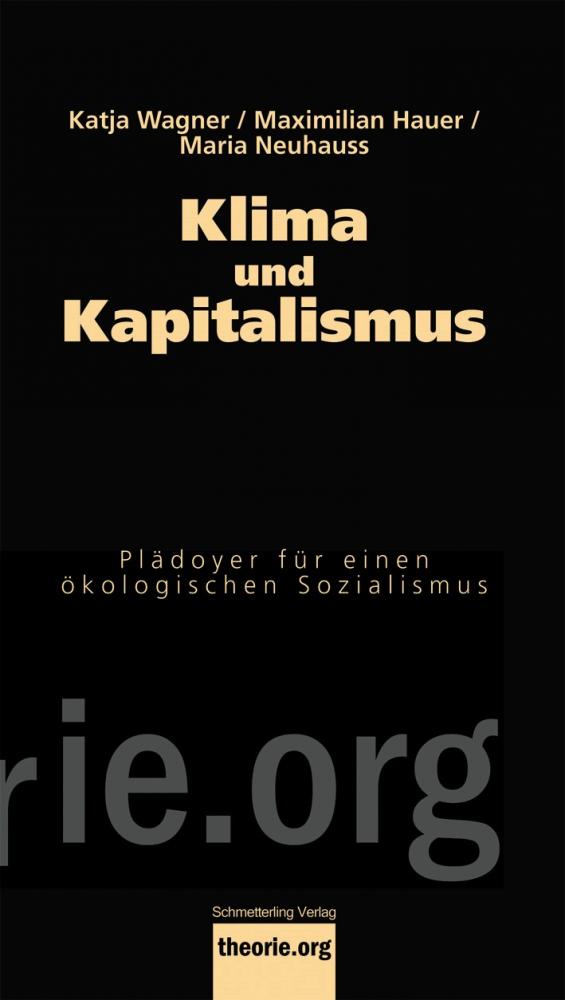Im Vergleich zu anderen politischen Ideologien hat die anarchistische Bewegung das Thema Ökologie bereits sehr früh aufgegriffen. Beginnend mit dem US-amerikanischen Aktivisten und Literaten Henry David Thoreau und seinem Walden-Experiment, über den französischen Geologen Elisée Reclus und den russischen Geografen und Anarchokommunisten Pjotr Kropotkin bis zum Briten William Morris, dessen Feuilletonroman „Kunde von Nirgendwo“ häufig als erste ökologische Utopie schlechthin angesehen wird, lässt sich eine ideengeschichtliche Entwicklung im Anarchismus des 19. Jahrhunderts erkennen.
Neue Zugänge zur Ökologiefrage
Der Schweizer Historiker Milo Probst zeichnet in seinem neuen Buch aber mehr als nur diese bereits bekannten und halbwegs erforschten Zugänge nach. Er rekonstruiert eine „Umweltgeschichte der Emanzipation“ anhand des anarchistischen Zugangs zur Ökologiefrage in der Zeit von 1865 bis 1920. Dabei beleuchtet er im Groben die Ideengeschichte von der ersten Formierung einer anarchistischen Bewegung in Gestalt von Organisationen bis zu ihrem ersten globalen Höhepunkt.
Den Inhalt fasst der Autor selbst in der Einleitung so zusammen: „Dieses Buch handelt davon, wie sich verschiedene Anarchist:innen zwischen 1870 und 1920 zu emanzipieren versuchten, indem sie die Welt anders zusammensetzten. Wie wir es erwarten würden, stand die Umgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt ihres Vorhabens. Doch umfasst ihre Wahrnehmung der Welt ebenso Tiere, Pflanzen und Gesteine. Derartige Dinge und Lebewesen wollten sie verschiedenartig in das anarchistische Projekt der Freiheit, Gleichheit und Solidarität einspannen: als Rohstoffe zur Befriedigung der Grundbedürfnisse, Materialien für künstlerisches Schaffen, Objekte der Erkenntnis und Erholung oder als Territorien für die Besiedlung waren sie Gegenstand anarchistischer Emanzipationsbegehren.“
Die Frage nach den Naturbeziehungen
Weiter schreibt er: „Anknüpfend daran frage ich nach den Verhältnissen zu den menschlichen und nicht-menschlichen Naturen, die Anarchist:innen anstrebten, um eine emanzipierte Gesellschaft zu errichten. Wie wollten sie Ressourcen aneignen und verwalten? Mit welchen Techniken beabsichtigten sie die Naturkräfte zu mobilisieren und die Lebensräume auszugestalten? Nach welchen nicht-produktiven Naturbeziehungen im Bereich der Bildung oder Kunst sehnten sie sich? Welche Territorien sahen sie als geeignet an, um ihre freiheitlichen Utopien zu verwirklichen? Unter anarchistischen Ökologien verstehe ich heterogene Themenfelder, in denen die Verhältnisse zur Natur Gegenstand von politischen Erwägungen über die Voraussetzungen, Ziele und Formen menschlicher Emanzipation waren.“
Zentral sind dabei für die Untersuchung vier Themenbereiche: Eigentum, Technik, Bildung und Globalisierung. Die Aspekte Eigentum, Technik und „Globalisierung“ – ein schrecklich nichtssagender Begriff – dürften unstrittig sein. Man würde zwar vielleicht noch das Mensch-Tier-Verhältnis oder Ernährungsfragen erwarten, die in der damaligen Bewegung ja bereits eine Rolle spielten, aber diese bleiben außen vor. Der Aspekt der Bildung – gerade, weil es nicht um Umweltbildung im eigentlichen Sinne geht – erschließt sich nicht unbedingt. Hier wären sicherlich noch weitere und bessere Bereiche zu finden gewesen.
Utopien mit kolonialen Zügen
Regionale Schwerpunkte der Studie sind in den ersten drei Kapiteln der französischsprachige Raum, damals ein wichtiges Zentrum der Bewegung, und im Anschluss daran Argentinien, wo vor allem die Gewerkschaft FORA wirkte. In Bezug auf anarchistische Utopien in Argentinien spricht Milo Probst von teils kolonialen Zügen.
Das begründet er so: „Kolonial waren anarchistische Utopien aber nicht einfach deshalb, weil sie ursprünglich aus Europa stammten, sondern vielmehr aufgrund von konkreten symbolischen Bereinigungen des Territoriums, die ich nachfolgend am historischen Material nachvollziehen möchte. Daraus folgt die Erkenntnis, dass anarchistische Ökologien nicht zwingend kolonial werden mussten und unter anderen Umständen in einer symmetrischeren Beziehung zu anderen Weisen, in der Welt zu sein, hätten münden können.“
Der Hinweis ist nicht unberechtigt. Bereits frühsozialistische Projekte in Tradition des Denkens von Étienne Cabet, Henri de Saint-Simon und Charles Fourier wiesen deutliche koloniale Aspekte auf.
Notfalls überblättern
Das Ausklammern des englischsprachigen Raums, in dem neben Morris ja auch Kropotkin wirkte, verwundert etwas und wird leider vom Autor nicht weiter begründet. Wahrscheinlich liegt es an den ihm zur Verfügung stehenden Materialien, vorrangig aus dem französischsprachigen Archiv CIRA in Lausanne.
Stellenweise sind Aussagen nicht ganz nachvollziehbar. So setzt der Autor zum Beispiel indirekt Naturisten und Anarchoprimitivisten gleich, zwei ganz unterschiedliche Strömungen innerhalb des anarchistischen Spektrums. Partiell muss man sich an den Schreibstil gewöhnen, nicht nur an die langen Sätze. So beginnt der Text mit den an eine Nabelschau erinnernden Worten: „Ich blättere durch ...“ Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen – höchstens vielleicht den Anfang einfach überblättern. Insgesamt ist es eine sehr lesenswerte Studie.
Rezension zu:
- Autor
- Milo Probst
- Titel
- Anarchistische Ökologien
- Unteritel
- Eine Umweltgeschichte der Emanzipation
- Verlag
- Matthes & Seitz, Berlin 2025
- Seiten, Preis
- 296 Seiten, 32 Euro
- ISBN
- 978-3-7518-2044-8