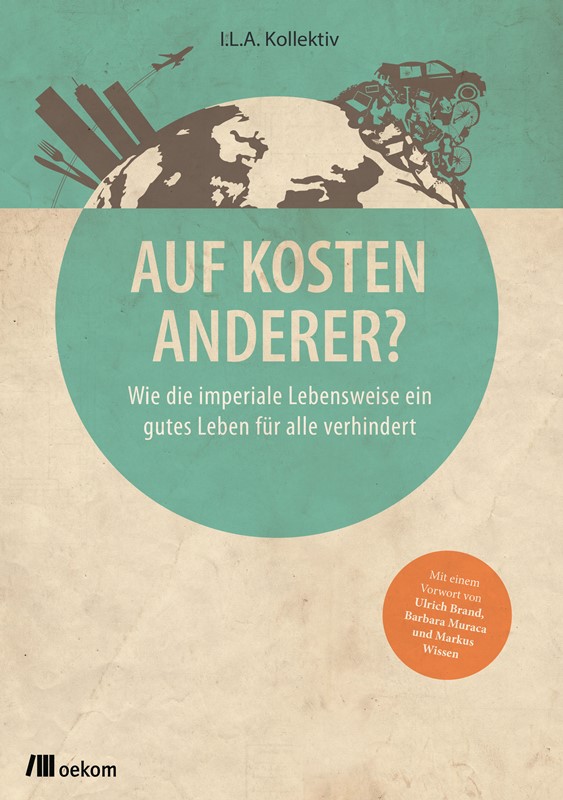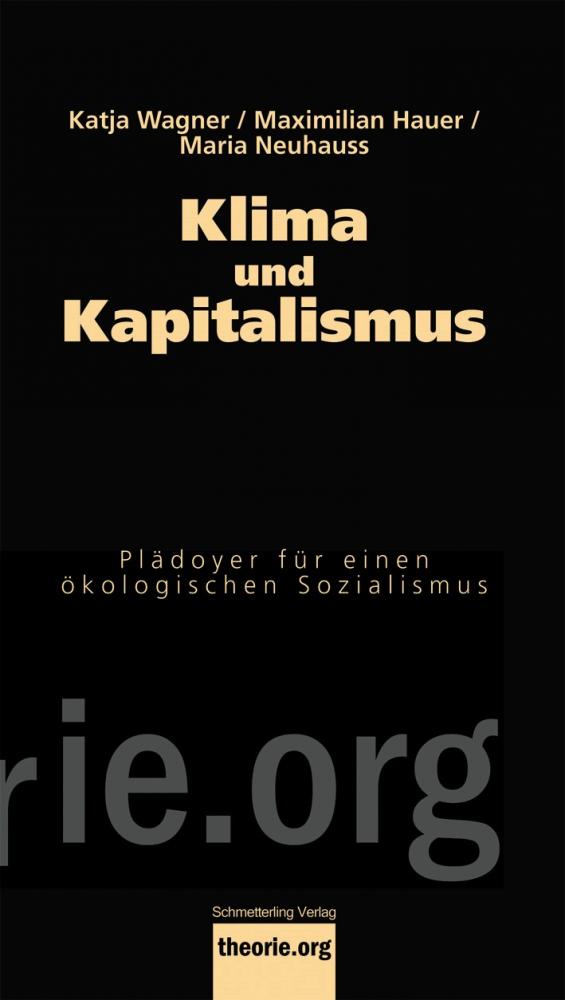Alle wissen, dass es schlecht ist, und tun es trotzdem. Die Absatzzahlen für SUVs steigen, die Fleischproduktion erreicht Rekorde und es wird geflogen wie nie. Gleichzeitig sagen drei von vier Deutschen, dass unsere Wirtschafts- und Lebensweise radikal erneuert werden muss. Noch nie ging die Schere zwischen Umweltbewusstsein und realen Taten in Deutschland so weit auseinander wie heute.
Fast täglich erreichen neue Meldungen von Plastikmüll auf einsamen Inseln, Rekord-Dürren oder Starkregen die Newsräume der Medien – doch trotzdem tut sich wenig. So krank auch das System ist, und obwohl diese Sicht mittlerweile fast Mainstream ist, bewegt sich der große Tanker der fossilen, kapitalistischen Wirtschaftsweise kaum in Richtung einer „großen Transformation“. Widerstand zwecklos?
An dem Phänomen haben sich 17 junge Wissenschaftler aus Göttingen ein Jahr lang abgearbeitet. Entstanden ist ihr Band „Auf Kosten anderer? Wie eine imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert“.
Schuld an der paradoxen Situation seien eine herrschaftliche Lebensweise und deren stabilisierende Momente, meint der Mentor und Initiator des Projekts, Markus Wissen. Der Professor für Transformationsforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin-Schöneberg hat zusammen mit dem Wiener Professor Ulrich Brand den Begriff der „imperialen Lebensweise“ entwickelt, an dem sich die Autoren des Buches entlanghangeln.
Die Analyse geht von einem urlinken Verständnis von Herrschaft aus: Der Status quo ist so lange stabil, wie eine Mehrheit der Deutschen oder der Bewohner des globalen Nordens von der Lebensweise profitiert – für Markus Wissen die „Normalisierung der Herrschaftsverhältnisse“.
Übersetzt heißt das: Obwohl wir von dem Schicksal der Näherinnen in Bangladesch wissen, kaufen wir trotzdem die schnittige Sommerbluse von Primark. Das ist paradox, weil wir als Konsumenten ja eigentlich nicht wollen, dass jemand 14 Stunden am Tag arbeitet, und schon gar nicht zwölfjährige Mädchen. Trotzdem kaufen wir es. „Der Einzelne kann sich diesem System nicht entziehen“, glaubt Markus Wissen, „wir werden als Konsumenten in diese Gesellschaft hineinsozialisiert“.
Der Konkurrenzgedanke breitet sich weltweit aus
Und weil wir als Konsumenten und nicht als Menschen handeln und denken, hat das laut den Wissenschaftlern zwei schwerwiegende Folgen. Zum einen wächst der Konkurrenzgedanke der Menschen untereinander. Und weil die Idee der imperialen Lebensweise – Eigenheim, Auto, Klamotten, Kreuzfahrt – sich verbreitet wie ein Flächenbrand, wollen zum anderen auch die Menschen im Süden der Erde ihren Anteil abhaben.
Das befeuert den Teufelskreis von Ausbeutung und gleichzeitigem Streben nach materiellem Wohlstand und Teilhabe und kann Menschen im Süden in die Flucht treiben. „Dadurch wird im globalen Norden das Konkurrenzdenken nur noch angefeuert und Rechtspopulisten erhalten Auftrieb“, schlussfolgert Markus Wissen. Konkret kann das heißen: Wenn Arbeiter aus Coltan-Minen im Kongo nach Deutschland flüchten, um hier ein besseres Leben zu führen, zünden ihnen deutsche Neonazis das Heim an. Wissen nennt das „ökoimperiale Spannungen“.
Auch die grüne Wende kann diese Dynamik nicht stoppen, solange sie in der „Logik des Systems“ bleibt, schlussfolgern die Autoren des Bandes. Sie beobachten „eine deutliche Zunahme konsumbasierter ‚Lösungen‘“. „Bei vielen dieser Lösungsstrategien handelt es sich um Ansätze mit einseitigem Fokus auf den individuellen Konsum und mit geringer Reichweite“, schreiben die Autoren. „Menschen können sich weiterhin persönlich entscheiden, Kaffee mit oder ohne Ausbeutung einzukaufen – Ausbeutung bleibt dabei die Norm.“
Als Negativbeispiele nennen die Autoren Ansätze wie Klimakompensation – das Freikaufen vom Klimaschutz mit kostengünstigen Projekten im Süden – oder auch den fairen Handel. Dies seien „Scheinlösungen“ und „oft Greenwashing“, also ein Weiter-so im grünen Mäntelchen. „Es handelt sich meist um eine Symptombekämpfung“, so das vernichtende Fazit.
Schade ist, dass hier nicht differenziert wird. Alles wird in einen Topf geworfen – auch wenn es sich um sinnvolle Entwicklungsprojekte oder ein strenges Label für fairen Handel handelt. Es geht den Autoren – wie oft bei linker Herrschaftskritik – ums große Ganze, also nicht um das Stück Kuchen, sondern um die Bäckerei.
Wie erklärt man das „gute Leben“?
Immerhin hat diese neue linke Kritik die Vorstellung überwunden, dass eine Änderung der Lebensweise erst nach der „Revolution“ – oder wie es heute heißt „Transformation“ – möglich ist. Zwar hilft der Kauf eines „Fairphones“ nicht, heißt es nun, aber dafür kann sich „mensch“ in „Gruppen solidarischer Landwirtschaft“ organisieren oder soziale Bewegungen unterstützen.
Anstelle von Konsumlösungen geht es um eine „solidarische Wirtschaftsweise“, die unter anderem aus kurzen Transportwegen, erneuerbaren Energien, Mehrfachnutzung und Recycling besteht.
Doch, so könnte man einwenden, das alles gibt es ja schon und viel verändert hat sich dadurch bisher nicht. Diese Ansätze sind weder neu noch breitenwirksam. Seit fast 50 Jahren, teilweise noch länger, werden solche alternativen Lebensweisen diskutiert und praktiziert, doch bis heute stecken sie in der Nische. Und so schön sie auch erscheinen, wäre es doch sinnvoll – bedenkt man das große Ganze – endlich mal zu überlegen, wie solche Lebensweisen für alle zugänglich werden könnten.
Natürlich wäre es toll, wenn diese Alternativen so attraktiv werden, dass die Leute nicht mehr nach acht Stunden Lohnarbeit vor dem Apple-Shop Schlange stehen, sondern es viel besser finden, sich im Nachbarschaftsgarten zur Salat-Ernte zu treffen. Ja, wir wissen es besser, aber niemand tut es – das alte Klagelied der Ökos und Linken. Also wie vermittelt man ein gutes Leben für alle? Die Frage bleibt auch nach der Lektüre dieses Buches offen.
Susanne Götze
I.L.A.-Kollektiv (Hrsg.):
Auf Kosten anderer?
Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert
Oekom Verlag, München 2017
128 Seiten, 19,95 Euro
ISBN 978-3-96006-025-3