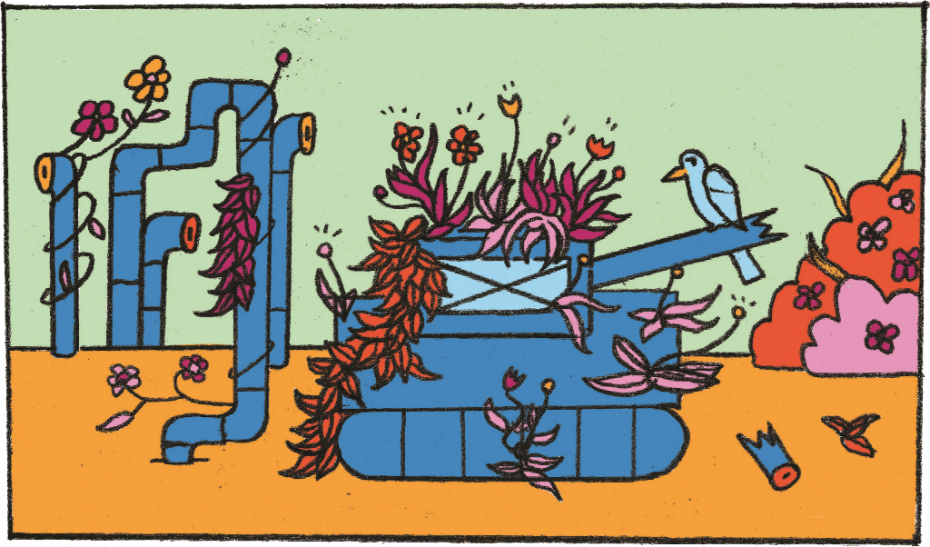Im September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele und 169 Unterziele für eine nachhaltige, gerechte und zukunftsfähige Erde, die „Sustainable Development Goals“ (SDGs). 15 Jahre, von 2016 bis 2030, haben die Unterzeichner*innen sich und ihren Nationen Zeit gegeben, um die Ziele zu erreichen. „Agenda 2030“ wird der Zielkatalog deshalb auch genannt. Was sind das für Ziele, und wie steht es um das Erreichen? Die kurze Antwort zu Letzterem: nicht gut.
Gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Schon vor den 17 Zielen gab es einmal acht UN-Ziele – die „Millennium Development Goals“. Bis 2015 sollten unter anderem die extreme Armut halbiert, Krankheiten bekämpft, Schulbildung gesichert und die Biodiversität geschützt werden. Auch wenn manches davon erreicht wurde, blieb so einiges liegen. Der größte Kritikpunkt war aber wohl ein anderer: Die Millenniumsziele sahen die Welt in Nord und Süd geteilt und ignorierten Forderungen nach Wohlstand und Industrialisierung im Süden, zum Beispiel in Afrika.
Die SDGs sind nun eine Fortsetzung, die diesen Kritikpunkt aufgenommen hat und zumindest auf dem Papier die Eine Welt schafft. Dabei gab es das erste Ziel (kein Hunger) bereits 1960, als sich die Vereinten Nationen zum ersten Mal so richtig ein Entwicklungsziel stellten – eben den Welthunger zu besiegen. Der Zeitpunkt war kein Zufall. Es war ein Jahr, in dem 17 neue, junge Staaten den Vereinten Nationen beitraten, so viele wie nie zuvor seit der Gründung, wodurch sich die Zusammensetzung der UN-Gremien und -Organisationen grundsätzlich änderte. Was für junge Staaten das waren, ist sicher leicht zu erraten – falls nicht: Einfach mal „Unabhängigkeit nach dem Kolonialismus“ googeln.
Auch wenn die SDGs also nur eine Fortschreibung von Zielen sind, die es in der einen oder anderen Form schon länger gab, wird ihr Erreichen immer wichtiger – und scheinbar immer schwieriger. Bei einigen Zielen wie Armutsreduzierung oder Klimaschutz läuft uns einfach die Zeit davon. Gleichzeitig kann kein Ziel isoliert betrachtet werden, ein Erfolg oder Misserfolg bei einem Ziel hat Auswirkungen auf andere Ziele. Fairer Konsum hilft beim Erreichen von Ziel 1 (keine Armut) und ermöglicht das Erreichen von Ziel 4 (hochwertige Bildung). Der Schutz der Biodiversität (Ziele 14 und 15) ist auch ein Beitrag zu den Zielen 13 (Klimaschutz), 3 (Gesundheit) und 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen).
Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Fünf Jahre vor dem Zieljahr sieht es nun ziemlich mies aus. Ein Grund: Es fehlte von Anfang an die Dringlichkeit. Die Millenniumsziele wurden einfach durch die SDGs ersetzt – als ob wir den Wecker auf „snooze“ gedrückt hätten. Nicht für 15 Minuten, sondern für weitere 15 Jahre. Auch wenn Pandemie und Kriege ihr Übriges dazu beitragen, die eigentlichen Ursachen liegen tiefer. Schließlich stagnierte zum Beispiel die Ernährungssicherheit schon beim Verkünden der SDGs im Jahr 2015 und nicht erst 2020. Außerdem ist es leicht, den Mund voll zu nehmen, wenn die verabredeten Ziele nicht bindend sind. Taten folgen zu lassen ist viel schwerer und kostet Geld, Zeit und Engagement, auch wenn wir alle früher oder später den Preis für das Nichteinhalten der Versprechen zahlen.
Eine weitere Kritik lässt sich überspitzt vielleicht so zusammenfassen: Die SDGs lesen sich wie das Ergebnis von Träumereien eines Schulprojekts, wie die Welt zu retten ist. Wie vage viele Formulierungen sind, zeigt schon Ziel 1 „Armut in jeder Form und überall beenden“ sehr eindrücklich. Ein Faktor ist auch die Politik. Die Entscheidungen zur Umsetzung liegen bei den Regierungen und sind damit vom politischen Klima im jeweiligen Land abhängig. Nach außen leben die Ziele von internationaler Kooperation, und auch die wird gerade immer schwieriger. Ganz abgesehen davon, dass 169 Ziele viel zu viel sind.
Doch die Kritik geht noch tiefer. Es würde zwar auch wieder eigene Probleme und Kritikpunkte nach sich ziehen, doch vielleicht sollten die Ziele eher Rechte sein. Das ist mehr als nur eine philosophische Frage. Ziele werden erreicht, und die, die sie erreichen, streichen die Lorbeeren ein. Aber hat nicht jede*r ein Recht auf ein friedliches Leben in Würde?
Gleichzeitig kostet das Erfüllen der Ziele viel Geld. Der globale Norden kann sich dies leisten, der Süden weniger. So verschärft die „Agenda 2030“ mit ihren 17 Zielen eines dieser Ziele zusätzlich, das Ziel 10 (weniger Ungleichheiten). Doch auch reiche Länder haben noch einen langen Weg vor sich, nicht erst seit Covid-Pandemie und Krieg. Bei Zielen wie Armutsbekämpfung und Geschlechtergerechtigkeit gibt es zwar Fortschritte, aber bei Weitem nicht genug, um sie zu erfüllen. Bei anderen Zielen lässt man sich Zeit, hier gibt es Stagnation oder aus verschiedenen Gründen sogar Rückschritte – wie beim Senken der CO₂-Emissionen. Ein Ziel, das von existenzieller Bedeutung für uns alle ist, wenn wir nicht in einer Zukunft à la „Soylent Green“ oder „Waterworld“ leben wollen.
Geld ist vor allem für weniger gut gestellte Länder ein großes Problem. Statt sich auf die größten Baustellen konzentrieren zu können, um eine nachhaltige Entwicklung für die Bürger*innen und die Umwelt voranzubringen und Erreichtes zu sichern, kommen immer mehr kleine und größere Baustellen dazu, bis womöglich gar nichts mehr geht, weil nichts zu Ende gebracht werden kann.
Wer trägt die Verantwortung?
Es fragt sich aber auch, wie fair die UN-Ziele eigentlich sind. Ein armes Land, vermutlich eines, das wieder und wieder von außen kontrolliert und ausgebeutet wurde, hat kaum die Möglichkeiten eines reichen Landes – und, wie der afrikanische Kontinent zeigt, auch seine eigenen, sehr berechtigen Interessen, die für die Menschen dort Priorität haben. Zudem war der Beitrag der armen Länder zum aktuellen Zustand der Erde – der zumindest einen Teil der Ziele notwendig machte – äußerst gering, während sie am stärksten darunter leiden. Einige Ziele betreffen auch nach wie vor Folgen des Kolonialismus. Muss nicht die Verantwortung und die Hauptlast beim Erreichen der Ziele vor allem auf dem globalen Norden liegen?
In den SDG-Ranglisten steht vor allem der Norden gut da. Zurzeit liegt Finnland an der Spitze mit einem Punktestand bei rund 86 von 100, wobei 100 bedeutet, dass alle Ziele erreicht wurden. Deutschland kommt auf Platz vier, Frankreich auf fünf und Großbritannien auf neun. Eine Punktzahl von mehr als 80 erreichen überhaupt nur europäische Länder. Am Ende des aktuellen Rankings stehen überwiegend afrikanische Staaten. Ihnen fehlen einfach die Mittel zum Erreichen der Ziele – die vielleicht auch gar nicht ihre eigenen Ziele sind. Inwieweit ist also der Norden in der Pflicht, mehr zu tun und zu geben, ohne weitere Bedingungen daran zu knüpfen? Schließlich waren es die reichen Länder, die den größten Schaden angerichtet haben.
Mitreden und mitgestalten
Kommt zu unserem ersten Runden Tisch und diskutiert mit uns, oder schickt uns einen Beitrag oder eine Frage. Ab der nächsten Ausgabe findet ihr hier immer vier Sonderseiten zu den 17 Zielen. Wir schauen genauer darauf, was bestimmte Ziele auszeichnet, wie es um die Erfüllung steht und was Menschen aus verschiedenen Ländern von ihnen halten. Eure Beiträge können diese Serie mitgestalten. In der nächsten Ausgabe geht es um die Ziele 1, 2 und 6.
Das Projekt „Der Rabe schaut über den Tellerrand“ wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesentwicklungsministeriums.